Von István Krómer
Haben Sie gehört, dass sich die slowakische Regierung für die beschämenden Bestimmungen der Beneš-Dekrete entschuldigt hat, die die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten der Bürger ungarischer und deutscher Herkunft einschränken, und dass sie die Tragödie, die unschuldige Opfer gefordert hat, zutiefst bedauert? Sie haben mich fast richtig verstanden.
Die Entschuldigung erfolgte in der Tat öffentlich unter Verwendung der genannten Begriffe, nachdem die Regierung der Slowakischen Republik sich moralisch verpflichtet fühlte, ihr Bedauern über das von der ehemaligen Staatsmacht begangene Verbrechen öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Das Verbrechen, um das es hier geht, waren jedoch nicht die Beneš-Dekrete, sondern die Veröffentlichung des Codex Judaicus/Zidovsky kodex vor achtzig Jahren, die den Juden aufgrund ihrer “rassischen” Identität ihre Menschen- und Bürgerrechte vorenthielt und es ihnen unmöglich machte, sich zu bilden und ein freies gesellschaftliches Leben zu führen. So wie die Slowaken es vier Jahre später mit den ungarischen und deutschen Bürgern taten – jetzt im Wissen um die Tragödie der Juden.
Außerdem wurde die ethnische Säuberung unter Benesch nicht gemäß einer imperialen ideologischen Forderung durchgeführt, wie es unter dem slowakischen Marionettenstaat Tiso der Fall war. Im Gegenteil: 1945 erhielt die Tschechoslowakei auf der Potsdamer Konferenz der Siegermächte trotz ihrer großen Bemühungen nicht das Mandat, die Ungarn in der Slowakei einseitig zu vertreiben, sondern nur die ungarisch-tschechoslowakische Bevölkerung auszutauschen. Was damit nicht gelöst wurde, machten sie dadurch wett, dass sie die verbliebenen Ungarn zur Zwangsarbeit ins Sudetenland deportierten, ihnen den Gebrauch ihrer Muttersprache untersagten und ihre Schulen wegnahmen.
Unter Anwendung der hohen moralischen Standards der Erklärung der slowakischen Regierung zum jüdischen Kodex und unter Verwendung der Sprache dieser Erklärung können wir all dies zu Recht als Verbrechen bezeichnen, wie es László Kövér, der Präsident des ungarischen Parlaments, kürzlich bei der Einweihung des Somorja-Denkmals für die aufgrund der Beneš-Dekrete deportierten Ungarn und Deutschen getan hat. “Die Entmündigung, Demütigung und Vertreibung aus der Heimat ist noch immer eine unvollendete Geschichte in unserer Erinnerung und eine offene Wunde in unserer Seele. Der gemeinsame christliche Glaube der Ungarn und Slowaken und das gemeinsame Schicksal Mitteleuropas sowie das gemeinsame Interesse unserer Staaten verpflichten uns alle, die offenen Wunden unserer gemeinsamen Geschichte des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert zu heilen.”
Aber in Ermangelung eines gemeinsamen Glaubens, eines gemeinsamen Schicksals und eines gemeinsamen Interesses haben die slowakischen Politiker es bisher versäumt, die einfachen, aber klaren Worte zu sprechen, die sie als ihre moralische Pflicht gegenüber den verfolgten Juden betrachteten. Die wenig konfrontativen Worte des ungarischen Präsidenten lauteten: “Wir erwarten mit sanfter, aber unerschütterlicher Geduld Ihre Geste der Entschuldigung und Genugtuung für die Verbrechen, die an den Ungarn begangen wurden, um des Friedens willen für kommende Generationen”.
Der slowakische Außenpolitiker Ivan Korčok reagierte darauf eher verärgert und wies die Idee, dass einer der höchsten öffentlichen Würdenträger Ungarns “seine eigene Lesart der Geschichte in der Slowakei präsentiert”, entschieden zurück: “Wir erhalten ständig Botschaften und Vorträge aus Budapest über unsere gemeinsame Geschichte.” Bratislava seinerseits hat das Buch der Vergangenheit geschlossen, aber wenn Vertreter des ungarischen Staates in der Öffentlichkeit über Themen sprechen, “die uns in das tragische 20. Jahrhundert zurückversetzen, schürt das nur negative Emotionen”.
Krisztián Forró, der Vorsitzende der Ungarischen Gemeinschaftspartei (MKP) im “Hochland” (ung. Felvidék, ein Begriff, gegen den sich Korčok besonders vehement wehrte), gab eine treffende Antwort, indem er sagte, dass dieses Kapitel der Vergangenheit nicht einseitig abgeschlossen werden kann, da “der Schatten der kollektiven Schuld immer noch da ist, sogar auf unseren Kindern”. Die Vergangenheit muss abgeschlossen werden, aber nicht, indem die strittigen Fragen unter den Teppich gekehrt werden. Denn nach den Worten von Péter Őry, Mitglied des MKP-Vorstands, wird das Ansprechen ungelöster Probleme und das Aufbegehren gegen deren Unterdrückung auch 2021 eine Provokation für die slowakische politische Elite darstellen.
György Gyimesi, ein ungarischer Abgeordneter der führenden slowakischen Regierungspartei OĽaNO, sagte, dass wir Ungarn an die gleiche moralische Genugtuung denken, die den Juden zuteil wurde; oder den Deutschen, bei denen sich das slowakische Parlament in einer Entschließung entschuldigte. Norbert Hegedűs, ein Journalist aus dem “Hochland”, sagte, eine Entschuldigung bei den verfolgten Ungarn sei längst überfällig, koste nichts und sei eine wichtige Geste. Die Tatsache, dass das slowakische Parlament seit 1993 nicht in der Lage war, dies zu tun, ist ein Zeichen für die Kleinlichkeit der führenden Politiker des Landes. László Bukovszky, der Minderheitenbeauftragte der slowakischen Regierung, sagte, die slowakische und die ungarische Regierung sollten eine Erklärung zur gegenseitigen Versöhnung verabschieden, die seit mehr als zwei Jahrzehnten aufgeschoben wurde. “Dieses Thema sollte auf eine professionelle Basis gestellt werden. Lassen wir den Historikern ihren Raum”, fügte er hinzu.
Es ist eine historische Tatsache, dass das Gesetz, das die Deportation der slowakischen Juden am 15. Mai 1942 anordnete, vom Parlament in Bratislava fast einstimmig verabschiedet wurde. Nur ein Abgeordneter stimmte dagegen, Graf János Esterházy, ein Vertreter der in der Slowakei verbliebenen ungarischen Minderheit, mit den Worten: “Als Ungar und Christ und als Katholik halte ich den Vorschlag für pietätlos und unmenschlich”. Dieser Mann, der sich nicht 80 Jahre später, sondern zum Zeitpunkt der Entscheidung moralisch verpflichtet fühlte, den Codex Judaicus zu verurteilen, wird vom slowakischen Staat immer noch als Kriegsverbrecher betrachtet… Hier beginnt der professionelle Diskurs.
Der Autor, István Krómer, ist Journalist.
Quelle: Magar Nemzet

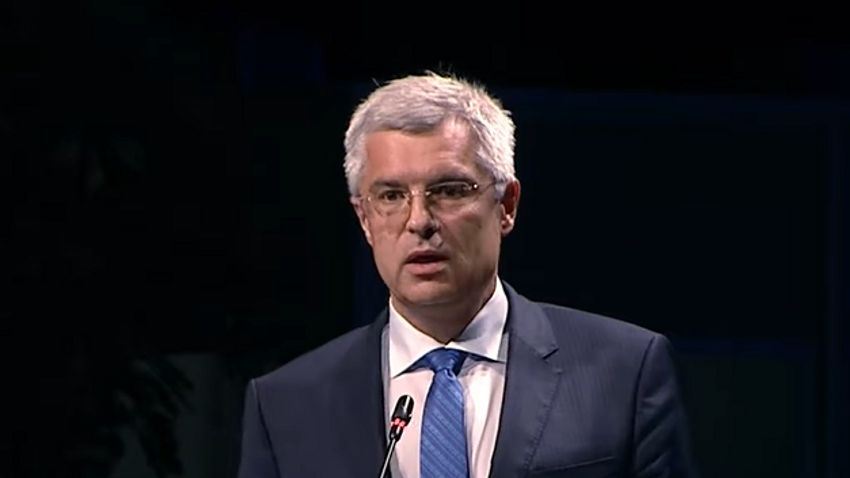






Ich als Ungar, bin in Bratislava in die Slowakische Schule gegangen. Es waren bittere Jahre. Slowaken hatten im 1938, nach der Gründung des Slowakischen Staates gnade Hitlers, das erste mal in der Geschichte an die Mappe der Welt aufgetaucht ein Slogan gehabt.
Tschechen zu Fuß nach Prag, Ungar über die Donau, Juden ins Donau.
Die Slowaken sind sehr „unfreundlich“ mit allen Nachbarn. Die Tschechen haben mit den auch die Nase voll. Ich weiß nicht warum, die Slowaken haben seit dem Sie als einheitliches Volk existieren überhaupt nichts auf den Tisch gelegt.
Die umbenennen die Namen der Ungarischen, Deutschen, Jüdischen Persönlichkeiten, Historischen Figuren und erfinden „Geschichten“ die Sie als Slowaken darstellt. Irrsin.
Mir hat mal ein Slowake im München gesagt daß der Ungarischer König István kein Magyar/Ungar war sondern er war ein UHORSKY König.
Es kommt einem die Weihnachtsganz Hoch, aber wirklich.
Wieder fehlt der politische Zusammenhang, vor allem fehlt der Hinweis darauf, daß die Slowakei sich im Krieg mit dem Kommunistischen Rußland befand. Die Russen hatten bereits 1941 fast alle Deutschen mit Waffengewalt aus ihren jahrhundertalten Siedlungsgebieten deportiert. Aber das ist selbstredend völlig unwichtig!
Es ist ein Jammer, daß gerade von sogenannten “Linksintellektuellen” ganz bewußt im Kriege getroffene Entscheidungen, die über Sieg oder Niederlage entschieden, mit politischen Entscheidungen der Nichtkriegszeit, einer Friedenszeit, vermengt werden.
Die Alliierten sind doch angetreten, um Europa den Frieden zu bringen. Tatsächlich brachten sie Menschenunrechte, Rache und Unfrieden! Leider traut sich kaum ein Politiker, dies deutlich auszusprechen.
Man sieht, ein Kongress zur Ausarbeitung eines Friedensvertrages mit allen 1945 kriegsführenden Nationen ist zwingend nötig!