Sloweniens versagende Justiz: Berüchtigte internationale Drogenhändler werden vom Obersten Gerichtshof freigelassen, während das Parlament Entschließung des Europäischen Parlamentes zu Totalitarismen erneut ablehnt
Von Peter Truden | Nach drei Jahrzehnten Demokratie in Slowenien sind die Grundsätze der Demokratie noch nicht vollständig von der staatlichen Justiz und dem politischen System übernommen worden.
Der Übergang vom ehemaligen kommunistischen Totalitarismus ist noch nicht abgeschlossen – weder moralisch noch politisch. Das bedeutet, dass Sozialkapital und institutionelle Zwänge die Übergangsjustiz beeinflussen. Studien haben gezeigt, dass die Korruption in einem Land umso geringer ist, je intensiver die Lustration zu Beginn des Demokratisierungsprozesses erfolgt. Doch was passiert, wenn die Lustration nicht stattfindet? Autoritäre Eliten schreiben dann die Regeln und Gesetze neu und gestalten den politischen Prozess, um auch in einer neu entstandenen Demokratie die politische Macht zu erhalten.
Ehemals totalitäre Strukturen haben sich auch im demokratischen Slowenien festgesetzt. Zwei aktuelle Fälle bestätigen den enormen Einfluss dieser Strukturen, die als tiefer Staat agieren:
Das erste Beispiel stammt vom 26. November 2021, als der slowenische Oberste Gerichtshof das Urteil des Bezirksgerichts in einem berüchtigten Fall namens Balkan Warrior aufhob. In diesem Fall ging es um ein Drogenhandelskartell aus dem Balkan, an dem Beamte aus mehreren EU-Mitgliedstaaten und europäischen Drittländern sowie Geheimdienstinformationen aus den USA beteiligt waren. Der Hauptprotagonist, Dragan Tosić, wurde nach Rechtskraft des Urteils im März 2018 zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der Fall ist nicht nur ein Beispiel für die gute Praxis der Zusammenarbeit verschiedener Staaten in Justizangelegenheiten, sondern auch ein Silberstreif am Horizont für den moralischen Kompass der europäischen Gesellschaft.
Doch zwei Monate, nachdem ein abgeordneter Richter Kmet mit dem Fall betraut wurde, ließ der Oberste Gerichtshof Tosić und seine Komplizen auf der Grundlage der Verfahrensentscheidung aus dem Gefängnis frei, obwohl die Überprüfungsakte mehr als 40.000 Seiten umfasste und das Urteil noch nicht öffentlich verkündet oder seine Begründung geschrieben wurde. Es ist daher unklar, wie und auf welcher Grundlage eine solche Entscheidung getroffen wurde. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass ein Gremium von Richtern es besonders eilig hatte, das Urteil bis nächste Woche aufzuheben, wenn ein Gesetz in Kraft tritt, das solche Fälle nicht mehr verjähren lässt. Nun wird das Verfahren verjähren und eine weitere Verhandlung verhindert werden. Was wir jedoch wissen, ist, dass der Prozess von einem Interessenkonflikt geprägt war. Einer der Richter, die die Entscheidung ausarbeiteten, wurde nämlich von dem Richter des Obersten Gerichtshofs betreut, der sich in der Schlussphase aus dem Beratungsverfahren zurückzog, weil er einst Tosić vertrat. Außerdem war Masleša – der Präsident des Senats – der letzte Richter, der im früheren totalitären Regime die Todesstrafe verhängte.
Ein solch eklatanter Interessenkonflikt, eine verblüffende Intransparenz und eine überhebliche Anspruchshaltung sind charakteristisch für das slowenische Justizsystem. Meritokratie, öffentlicher Dienst und Gerechtigkeit für alle sind Begriffe, die ihm noch immer fremd sind.
Das zweite Beispiel stammt vom 25. November 2021, als das slowenische Parlament erneut nicht in der Lage war, die Entschließung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2009 zu europäischem Gewissen und Totalitarismus anzunehmen (angenommen im EP mit 553 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen und 33 Enthaltungen). Das slowenische Parlament lehnte die Entschließung bereits zum vierten Mal seit 2015 ab. Mit anderen Worten: Das slowenische Parlament ist nicht in der Lage, totalitäre Regime für all das Böse, das sie verursacht haben, zu verurteilen. Trotz der Millionen von Menschenleben, die sie weltweit und Zehntausende in Slowenien gefordert haben, ist das slowenische Parlament nicht in der Lage, Nazismus, Faschismus und Kommunismus zu verurteilen. Von den 90 Mitgliedern des Parlaments haben 45 gegen etwas gestimmt, das eine große Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments angenommen hat. Damit haben diese Abgeordneten gegen die historischen, moralischen und politischen Grundlagen der EU gestimmt.
Sie sind offensichtlich ein Teil der hartnäckigen totalitären Strukturen, die in Slowenien noch immer bestehen. Ihr Verständnis von Recht und Gesetz beruht eindeutig auf der Weigerung, sich mit der realen, historischen Wahrheit totalitärer Regime – im Falle Sloweniens des Kommunismus – auseinanderzusetzen. Dies erlaubt ihnen, weiterhin einen selektiven Ansatz im Umgang mit Totalitarismen zu verfolgen und die massiven, systematischen Menschenrechtsverletzungen, die im Kommunismus stattgefunden haben, nicht anzuerkennen. Das entspricht natürlich nicht den Idealen, die die EU vertritt und anstrebt, und auch nicht den demokratischen Werten, Normen und Grundsätzen, auf denen die Rechtsstaatlichkeit beruht. Entfernt man die Fassade und die hochtrabenden Worte, kommt ein totalitärer Wolf im demokratischen Gewand zum Vorschein.








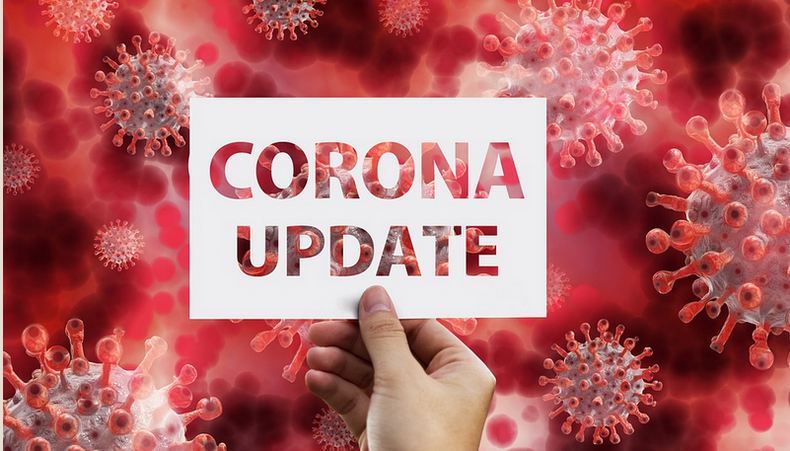
Warum erinnewrn wir uns nicht an die 2561 AUSRADIERTEN? Nach dem 10 Tage Krieg radierte der damalige Minister des MdI Bavcar alle Slowenischen Bürger aus anderen ehemaligen Republiken aus dem Register der Sloweniens Staatsbürger und man nahm denen ALLE Menschenrechte bis auf das Leben. Einige klagten vopr dem EUGMR und die Kläger gewannen geghen Slowenioen. Slowenien wurde verurteilt den Status vor derer5 Ausbvürgerung wieder herzustellen und alle Schäden wieder gut zu machen. 5000 erhielten ihre Rechte wieder zurück ( von 25671 ) und danach verweigerte Slowenien den Vollzug des Urteils. EUGMR hat keinew Kontrolle über die Vollstreckung seiner Urteile, und so herrscht inb Slowenien eine Willkür. Die Restlichen AUSRADIERTEN blöeiben Opfer eines Genopciod.
Sodniki, ki so jim diplome pogorele. Ob kandidaturi za so samo izjavili, da diplomirani pravniki Očitno so zasedli sodniško mesto brez dokazil.
Übersetzung aus dem Slowenischen: “Richter, deren Diplome verbrannt wurden. Als sie sich um das Richteramt bewarben, gaben sie lediglich an, dass sie ein Jurastudium absolviert hatten.”
Und an welcher Stelle ist der Grund der Empörung? Dragan Tosić ist ein CIA-Agent, punkt.
Vielleicht sollten unsere Juristen und Politiker mal alle nach Slowenien um denen zu erklären wie man es richtig macht?
Dann wird es dort zwar auch nicht besser, aber wir wären die Mischpoke wenigstens hierzulande los.