Im Internet mitgehört und mitgeschrieben von Wilhelm Tell
Argentinien -Die Stadt Buenos Aires setzt auf Gesichtserkennung, 75 Prozent der Stadtfläche sind videoüberwacht. Schon wenige Monate nach der Installation des Systems im Jahr 2019 verkündete die Regierung, dass fast 1700 gesuchte Straftäter gefasst worden seien. Doch Datenschützer verklagten die Stadt aufgrund von Fällen wie dem von Guillermo Ibarrola. «Ein Albtraum!» So beschreibt Guillermo Federico Ibarrola die sechs Tage, die er im Gefängnis verbracht hat. Das Gesichtserkennungssystem an einem Bahnhof in Buenos Aires hatte in ihm einen gesuchten Straftäter erkannt. Dabei war es ein Namensvetter, der einen Raubüberfall begangen hatte. «Jemand hatte wohl aus Versehen meine ID-Nummer ins System eingegeben statt der des Gesuchten», erklärt Ibarrola. «So ein Fehler kann ein Leben zerstören.» Von der Justiz bekam er einen Kaffee zum Mitnehmen und ein Busbillett nach Hause. SRF.ch
Belarus – Nobelpreisträger 2022 Ales Viktorvitsj Bjaljazki Алесь Віктаравіч Бяляцкі (60) wurde wegen Schmuggels und Steuerhinterziehung am 3. März 2023 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen Verrat wurde Swetlana Tichanowskaja zu 15 Jahre hinter Gitter verurteilt. Zuvor war sie nach Litauen geflohen. SRF.ch
China – China will seine Militärausgaben in diesem Jahr um 7,2 % steigern. Dabei handelt es sich um einen deutlichen Anstieg des Verteidigungsetats auf 1.5537 Billionen Yuan (umgerechnet 211 Milliarden Franken).
Der chinesische Mineralölkonzern CNOOC hat nach eigenen Angaben im Golf von Bohai ein aussichtsreiches Öl- und Gasvorkommen entdeckt. Das Unternehmen schätzte in der entsprechenden Pressemitteilung vom Mittwoch die dortigen Reserven auf 100 Millionen Tonnen Rohöl ein. Das Ölfeld wurde Bozhong 26-6 genannt. Wie der Staatskonzern bekannt gab, befinde sich das Vorkommen im Süden des Golfs von Bohai. Dieses Randmeer des Gelben Meeres weise eine durchschnittliche Wassertiefe von 22 Metern auf. Das Unternehmen habe dort ein 4’480 Meter tiefes Loch gebohrt und sei dabei auf mehr als 321 Meter Ölschichten gestossen. Während der entsprechenden Tests habe das Bohrloch 2’040 Barrel Rohöl und 324’000 Kubikmeter Gas pro Tag geliefert. CGTN.cn
● Es ist ruhig beim neuen grossen Containerhafen von Schanghai. Lastwagen stehen überall am Strassenrand. Die meisten Fahrer verkriechen sich an diesem kaltregnerischen Tag in den Kabinen. Einer der Fahrer steigt runter fürs Gespräch: «Das Geschäft läuft schlecht. Wenn jemand meinen Lastwagen kaufen will, ich würde ihn sofort verkaufen. Ich habe ja nichts zu tun. Ich erhalte aktuell nur sieben bis acht Aufträge pro Monat und die Bezahlung ist erst noch schlecht.» In normalen Zeiten habe er 20 Aufträge im Monat. Doch es würden immer weniger. Auch die offiziellen Zahlen zeigen abwärts. Die letzten aktuellen Exportdaten für vergangenen Dezember stehen bei minus 9.9 %. Eine wichtige Ursache dafür ist die schlechte wirtschaftliche Lage in Europa und den USA. Läufts dort schlecht, sinkt die Nachfrage nach chinesischen Gütern. Immer mehr Güter werden in anderen Ländern produziert. Einerseits wegen Handelskonflikten, andererseits, weil China nicht mehr ein Billigst-Produktionsstandort ist. Während die Exporte sinken, steigt der Frust bei den Lastwagenfahrern am Hafen. «Unsere Generation muss viel Druck aushalten. So viele Ausgaben: Die Ausbildung der Kinder, die Hypotheken, die Gesundheitskosten der Eltern. Ich hatte 100’000 Yuen (14’000 Franken) gespart. Dann wurden meine Eltern krank. Jetzt habe ich Schulden.» Tatsächlich hat die Regierung realisiert, dass die Situation brenzlig ist. Deshalb haben die Behörden Kredite organisiert für eigenständige Lastwagenfahrer und kleinere Logistik-Firmen.
● China bald LNG-Importeur Nr. 1. Peking ist hungrig nach Flüssiggas. Zurzeit sichert sich China Flüssiggas aus der ganzen Welt. Damit wächst die Angst in Europa vor neuen Gasengpässen. SRF.ch
● Wo in Europa der russische Gashahn zugedreht wird, öffnet sich der Hahn der „Power of Siberia“. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Kubikmeter Gas, die zu Haushalten und Unternehmen in China gelangten, um nicht weniger als 50 %. Auch der Handel mit Öl und Kohle nimmt zu. Eine neu gebaute Brücke, die Heihe mit Blagoweschtschensk verbindet, wurde im vergangenen Sommer eröffnet. „Freundschaft, Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Hu Chunhua über das symbolträchtige Projekt. Hier ist noch nicht viel Verkehr: In einer Stunde zählen wir nur zwei Lastwagen. Aber insgesamt wächst der Handel um 30 %: Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 190 Milliarden Dollar gehandelt. China füllt die Lücke, die westliche Unternehmen hinterlassen haben. Chinesische Autohersteller gewinnen schnell Marktanteile, chinesische Smartphone-Hersteller haben laut der Forschungsagentur Counterpoint inzwischen 95 % des Marktes. Ein Jahr zuvor waren das noch 40 %. NOS.nl
Deutschland – Fleisch gehört zur deutschen Identität. Egal ob Wurst oder Schnitzel, gegessen werden gerne üppige Portionen vor allem billigen Schweinefleischs. Eine hocheffiziente Fleischproduktion und Billiglöhne sorgen für günstigen Nachschub. Doch Ansprüche an Moral und Qualität stellen Omas Rezepte in Frage. «Super, wirklich super» schwärmt Michael Wagner mit vollem Mund von der Currywurst, die er mitten auf einer Kreuzung in Berlin auf die Schnelle isst. Im Imbissstand bereitet Tarek die Würste im Stakkato zu. Viele Deutsche lieben schnelles, billiges Essen und Fleisch gehört einfach dazu. Schon die alten Römer fanden, dass die Germanen keine ausgeprägte Esskultur haben. Das schlichte Essen gehört zur deutschen Identität und Fleisch wurde zum Kulturgut. Seine Verfügbarkeit für alle sorgte einst für politische Stabilität. Landwirte wie Henning Kock produzieren günstiges Schweinefleisch. Im sogenannten «Schweinegürtel», einer Region südwestlich von Bremen, hält er 2600 Tiere. Sie sind genetisch so veranlagt, dass sie sich trotz dauernder Verfügbarkeit von Futter nicht überfressen und rund 900 Gramm pro Tag zulegen. Mit Fleisch verdient auch Alina Henrici ihr Leben. In ihrer Metzgerei in Hessen lädt sie Kinder in die Wurstküche ein, damit diese verstehen, dass die Wurst nicht vom Discounter, sondern vom Tier kommt. Für viele ist Fleisch nicht wegzudenken. Doch nun streicht Freiburg im Breisgau das Fleisch vom Menu der Grundschulen und Kitas. Die Aufregung ist gross. «International» SRF.ch
● Deutsche suchen die teuerste Gurke, das Symbol der hohen Inflation. Der Preis für dieses Gemüse kann in manchen Supermärkten bis zu 3,29 Euro erreichen. NOS.nl
● In Berlin hat die Internationale Tourimusbörse ITB geöffnet. Anders als in den Jahren vor Corona können allerdings nur Fachbesucher kommen. Für die weltgrösste Tourismusmesse haben sich rund 5’500 Ausssteller aus mehr als 160 Ländern angemeldet. RBB.de
Estland – Estland hat ein neues Parlament gewählt. Die pro-europäische Reformpartei von Regierungschefin Kaja Kallas hat am Sonntag einen deutlichen Wahlsieg errungen. Die liberale Fraktion kommt demnach auf einen Wähleranteil von knapp 32 %. Damit holt sie sich 37 von 101 Sitzen im Parlament in Tallinn. Die rechte Ekre-Partei erreicht mit 16.1 % den zweiten Platz. Das starke Abschneiden spiegelt die Besorgnis einiger Wähler über die steigenden Lebenshaltungskosten in dem Land mit seinen 1.3 Millionen Einwohnern. SRF.ch
Frankreich – die Gewerkschaften drohen mit unbefristetem Streik. SRF.ch
Japan – In Japan werden Haustiere zum Familienersatz. Es werden immer weniger Kinder geboren. Katze statt Kind: Die Regierung ist in Sorge: An flauschigen Mitbewohnern mangelt es nicht. SRF.ch
Malta – Italien, Griechenland, Spanien und Zypern fordern von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex mehr Einsatz im Kampf gegen Migrantenboote und Schleuser. Bei einem Treffen in Maltas Hauptstadt Valletta am Wochenende betonten die zuständigen Minister, dass Frontex mehr Mittel in die Überwachung der EU-Aussengrenzen stecken müsse, einschliesslich der internationalen Gewässer im Mittelmeer. SRF.ch
Mexiko – Über 100 Minderjährige. Polizei findet 343 Migranten in einem Lastwagen in Veracruz. SRF.ch
Militär – Die Vereinigte Staaten haben weltweit das grösste Militärbudget mit fast 700 Mrd. Franken für 1.5 Mio Soldaten, 3,4% vom BNE, gefolgt von der Europäischen Union (zusammengerechnet) mit 218 Mrd in den 27 Mitgliedstaaten mit fast 1.5 Mio Soldaten und einem Budget von 1,75% vom BNE. Die Volksrepublik China hat über 2 Mio Soldaten in der Volksbefreiungsarmee, mit einem Budget von 167 Mrd., 1,9 % vom BNE. Dann Russland mit 1,2 Mio Soldaten und einem Budget von unter 80 Mrd., 3,9 % vom BNE. Indien hat fast 1,5 Mio Soldaten und ein Budget von 69 Mrd. F ranken, 2,4% vom BNE. Frankreich hat 200’000 Soldaten und ein Budget von 55 Mrd., 1,9%, Deutschland 183’000 Soldaten, 53,5 Mrd., 1,38 %. Nordkorea kommt mit 4,6 Mrd. aus, 25%(!) vom BNE und 1,2 Mio Soldaten. %uell geben vor allem Israel und arabische Länder viel aus: Oman (8,8), Saudiarabien (8), Eritrea (6,3), Algerien (6), Syrien (5,9), Angola, VAE, Kuwait (je 5,7), Israel (5). Das Schweizer Milizsystem hat 143’500 Soldaten und 4,5 Mrd. Franken Budget (0,66 %). Österreich hat bei einem Budget von 2,7 Mrd. Franken (0,64%) 39’000 Soldaten. Die USA verfügen über 100 Militärbasen in 85 Ländern, Grossbritannien in 18 Ländern, Frankreich in 13 Ländern, Türkei in 9 Ländern, Russland hat nur eine Base in Syrien, die sich ausserhalb der ehemaligen UdSSR befindet. Indien hat in 6 Ländern Basen. China in 3 Ländern Dschibuti, Tadschikistan, Saudi Arabien. Der Iran verfügt über Basen im Irak, Syrien, Libanon. SRF.ch
Nordkorea – Nordkorea warnt Washington: Abschuss unserer Raketen wäre Kriegserklärung. VOK.kp
Österreich – Die SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser landete bei 38,9 % – und stürzte damit um satte neun Prozentpunkte ab. Die FPÖ folgt mit 24,6 %, einem Plus von 1,6 %punkten. Ebenso viel konnte die ÖVP zulegen, das bedeutet mit 17,0 % klar Platz drei. Die größten Zugewinne des Wahltags, 4,4 %punkte, konnte das Team Kärnten von Gerhard Köfer einfahren. Mit 10,1 % komplettiert es die vier im Landtag vertretenen Parteien. Denn die Grünen scheiterten mit 3,9 % am Wiedereinzug, NEOS verpasste den Sprung in den Landtag mit 2,6 deutlich. Auf immerhin 2,4 % kam Vision Österreich, ein Ableger der impfkritischen MFG. Zum dritten Mal in Folge hat die Partei des Landeshauptmanns bzw. der Landeshauptfrau mehr als neun %punkte verloren. Nach der ÖVP in Tirol und Niederösterreich ist es nun die SPÖ in Kärnten, die zwar stärkste Kraft bleibt, aber einen empfindlichen Absturz hinnehmen muss. 70% WB. ORF.at
Polen – Seit dem Beginn des Ukrainekriegs hat sich der Flughafen Rzeszów-Jasionka zu einer Drehscheibe für militärische Hilfeleistungen aus dem Westen entwickelt und muss entsprechend geschützt werden. SRF.ch
Rumänien – Der Handel mit illegal geschlagenem Holz gilt mittlerweile als eine der Haupteinnahmen der organisierten Kriminalität – gleich nach dem Drogenhandel und dem Geschäft mit gefälschten Produkten. Interpol und Europol gehen davon aus, dass bis zu 30 % des weltweit gehandelten Holzes illegal geschlagen werden. Mit einem Marktvolumen von 50 Milliarden Euro. Wie das kriminelle Netz funktioniert und wer profitiert, zeigt eine neue Recherche von 140 Journalisten. Benedikt Strunz vom Norddeutschen Rundfunk NDR war dabei auf den Spuren der Holzmafia in Rumänien unterwegs, wo jährlich riesige Waldgebiete illegal abgeholzt werden. Das Land hat deshalb auch ein EU-Verfahren am Hals, weist aber jegliche Vorwürfe zurück und verweist auf die Fortschritte in der Korruptionsbekämpfung. In Rumänien kam Strunz in Kontakt mit Insidern. Darunter ein Ex-Mafioso, der als Staatsförster im Auftrag seines Chefs einen illegalen Forstbetrieb aufgebaut haben soll. Mit dem Gewinn seien dann Politiker, aber auch ein hochrangiges Mitglied der Polizei bestochen worden. Mehrere Quellen vor Ort hätten dieses korrupte System bestätigt. «Man geht davon aus, dass fast die Hälfte des in Rumänien geschlagenen Holzes illegal gewonnen wird», stellt Strunz weiter fest. Korruption und Gewalt seien häufig, und auch vor Mord werde nicht zurückgeschreckt. Dazu immer wieder tätliche Angriffe auf Journalisten, Umweltaktivisten und Forstangestellte. Im Land selbst ist die Nachfrage nach Holz eher gering. Der Hunger nach Rumäniens letzten Urwäldern kommt somit von westlichen Konzernen, die vor Ort stark vertreten sind. Laut Strunz sind es insbesondere drei österreichische Unternehmen, die dort Pellets, Pressspanplatten und Billigmöbel für ein grosses Möbelhaus produzieren – und jegliche illegalen Aktivitäten von sich weisen. Kontrollen sind schwierig. Bei mehreren Razzien gegen Holzunternehmen in der Region Suceava im Nordosten des Landes wegen illegalen Holzschlags, Steuerhinterziehung und Geldwäsche ging kürzlich auch ein Polizeibeamter ins Netz. Es soll 300’000 Euro Schmiergeld kassiert haben, um Ermittlungen gegen einen Holzkonzern zu beeinflussen. Strunz verweist zugleich auf die weltweit schwache Gesetzeslage gegen Umweltkriminalität. Dies gelte auch für die EU-Holzhandelsrichtlinie, das Holzsicherungsgesetz in Deutschland und vergleichbare Gesetze. Die Ermittlungsbehörden hätten auch nur wenig Möglichkeiten für ein hartes Vorgehen, und die angedrohten Strafen seien sehr gering, so Strunz. «Die Mittel im Kampf gegen Umweltkriminalität sind angesichts von deren Bedeutung verschwindend klein, wenn man etwa die Anstrengungen gegen den Drogenhandel betrachtet.» Auch in die Wahlkampfkassen von Parteien dürften Gelder aus der illegalen Forstwirtschaft fliessen.
● In den 1970er-Jahren wohnte sie mit ihrer Familie noch drüben neben der Kirche. Jetzt ist die Turmspitze im See die letzte Erinnerung ans Dorf Geamana. Diktator Ceausescu liess die tausend Menschen aus dem Dorf umsiedeln, für die Kupfermine oben in den Bergen. Er entschädigte sie nur mickrig. «Kommt rein», sagt Prata. Sie legt gerade Bohnen und Erbsen ein, macht alles selbst. Nur das Wasser trinkt sie nie, Wasser müssen ihr die Kinder vorbeibringen. Sie meidet den See: «Beim Baden geht die Haut ab.» Manchmal steige gelblicher Nebel aus dem Wasser und brenne in den Augen. Cuprumin verdient gut, der Zeitgeist ruft nach Kupfer – für Solarzellen, Windturbinen und elektrische Autos. Auf jeden Fall will der Konzern noch mehr Kupfer abbauen und den Damm erhöhen, der den künstlichen See zusammenhält. Man will vielleicht bald noch ein Tal fluten. Cuprumin redet nicht mit den Medien, schreibt bloss: «Wir tätigen die obligatorischen Investitionen für Umweltschutz, die die rumänischen Gesetze und die europäischen Normen vorschreiben.» Aus Rohren rund um den See fliesst etwas Milchiges – Kalk, den Curpumin in den See schüttet, der das saure Wasser aus der Mine neutralisiert. Früher funktionierte das schlecht, sodass immer wieder verschmutztes Wasser aus dem See floss und tonnenweise Fische starben. Heute aber sagen die rumänischen Behörden: alles gut. Nichts ist gut, sagt hingegen Peter Hantz, Biochemiker und Chronist rumänischer Umweltsünden. Er hat Wasserproben rund um die Kupfermine genommen. Ergebnis: Der Kalk mag das Wasser reinigen, die giftigen Metalle – Cadmium, Kupfer, Aluminium – lagern sich aber als Sedimente auf dem Boden ab. Diese werden aus dem See in die Flüsse weiter unten geschwemmt – und damit in die Nahrungskette. Die Werte liegen weit über den Normen. SRF.ch
Russland – Putin zieht Parallelen. Der Kosovo-Krieg als Präzedenzfall für den Ukraine-Krieg. Die Sanktionen sollen Russlands Kriegsmaschinerie lähmen. Bis es so weit ist, dürften aber noch einige Jahre vergehen. SRF.ch ● Munition wird knapp. Der Gründer der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat der Regierung in Moskau mangels Munitionsnachschubs mit einem Rückzug aus der umkämpften Stadt Bachmut gedroht. China könnte, möchte aber nicht liefern. Auch für die Ukraine dro«ht Munitionsknappheit. ORF.at
Schweiz – «Die Schweizgibt ihre Neutralität auf». Das waren die weltweiten Schlagzeilen, als der Bundesrat vor einem Jahr verkündete, dass die Schweiz die EU-Sanktionen gegen Russland übernimmt.
● «Auch für die Kantonspolizei Bern ist dieser Fall aussergewöhnlich», sagt Sprecherin Isabelle Wüthrich gegenüber SRF. Es seien mehrere Spezialdienste, Polizeikorps und Sonderermittlerinnen beteiligt gewesen. Die Kantonspolizei Bern kam den Betreibern der beiden Plattformen im Februar 2022 auf die Schliche. Damals gingen Meldungen ein, wonach auf dem Messengerdienst Telegram Drogen verkauft würden. Die Ermittler stiessen im Darknet auf die Drogenplattformen «Heisenbergs Apotheke» und «Candy Shop by Vespair». Die Bestellung zahlten die Käufer mit Bitcoins, danach wurden die Pakete per Post versandt. Der Erste, der insgesamt drei mutmasslichen Betreiber, wurde bereits im Oktober 2022 in Grenchen (SO) gefasst. Vier mögliche Drogenkuriere im Alter zwischen 27 und 35 Jahren gingen den Fahndern kurz darauf in den Kantonen Luzern und Zürich ins Netz. Am 28. Februar verhaftete die Polizei schliesslich die beiden weiteren Plattformbetreiber. Bei Hausdurchsuchungen fanden Polizeikorps in verschiedenen Kantonen mehrere Kilogramm Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente. Auch der mutmassliche Lieferant der Drogenplattformen wurde ermittelt. Die drei Betreiber der Plattformen versorgten mehrere tausend Kunden und machten einen Umsatz in Millionenhöhe. «Aktuell ermitteln wir noch, wie hoch der Betrag ist», sagt Isabelle Wüthrich von der Kantonspolizei Bern.
● Als erste Energieversorgerin der Schweiz nimmt die Solothurner Regio Energie im Rahmen eines Pilotversuches ein kleines Flüssiggas-Terminal in Betrieb. Im März will das Unternehmen 33 Tonnen Flüssiggas ins lokale Gasnetz einspeisen, das entspricht einer Energiemenge von rund 500’000 Kilowattstunden und deckt etwa den Jahresbedarf an Wärme von 25 Einfamilienhäusern. Durch den Pilotversuch mit Flüssiggas, auch LNG genannt, wolle man Erfahrungen sammeln und prüfen, ob sich die Technologie in der Praxis bewährt. Am Einsatz von Flüssiggas gibt es auch Kritik. Weil es sich um fossile Energie handelt, wehren sich zum Beispiel in Basel Klimaschützer gegen ein geplantes LNG-Terminal. Erdgas ist bei normalen Temperaturen gasförmig. Kühlt man es jedoch auf minus 162 Grad ab, wechselt es den Aggregatszustand von gasförmig zu flüssig. Dadurch reduziert sich das Volumen des Gases enorm. Flüssiggas braucht 600 Mal weniger Platz, die darin enthaltene Energiemenge bleibt jedoch gleich. Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch die Verflüssigung ist die Energie in viel kompaktere Form gebracht und lässt sich einfacher über weite Distanzen transportieren via Schiff, Bahn oder Strasse. Ausserdem kann flüssiges Gas auch von Fördergebieten bezogen werden, die nicht mit Pipelines ans internationale Gas-Transportnetz angeschlossen sind, was auch die Abhängigkeit von den russischen Gasimporten vermindern würde. Für die Einspeisung in ein bestehendes Gasnetz muss das extrem kalte Flüssiggas vor Ort wieder erwärmt werden, damit es wieder in den gasförmigen Zustand wechselt. Anschliessend kann es via normales Netz an Haushalte zum Heizen verteilt werden oder es kann zentral zur Wärme- oder Stromproduktion verwendet werden. Verflüssigtes Erdgas ist auch unter dem Begriff LNG bekannt, der englischen Abkürzung für Liquified Natural Gas. Wichtige internationale Lieferanten von LNG sind die USA, Katar, Malaysia und Australien.
● Daten sind das neue Gold – ein Rohstoff von immensem Wert und für die Gesellschaft von zunehmender Bedeutung. Mit immer besseren Hard- und Software-Technologien können Daten in nie dagewesenem Umfang gesammelt und analysiert werden. Ein nationales Forschungsprogramm hat sich seit 2015 in 37 Projekten mit «Big Data» in der Schweiz beschäftigt. Alle mit dem Ziel, Forschung und Innovation in diesem Bereich zu fördern. Der allgemeine Schluss: «Big Data» könne das tägliche Leben verbessern, solange sie verantwortungsvoll genutzt werden. Gleichzeitig sei «Big Data» eine Herausforderung für demokratische Prozesse, Gleichbehandlung, Fairness oder das Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum. «Eine Versicherung könnte heute beispielsweise genaue Risikoanalysen machen und individuelle Policen erstellen», erklärte Friedrich Eisenbrand, Mathematiker an der ETH Lausanne. Dies gefährde das Solidaritätsprinzip. Wir haben uns an erstaunlich genaue Kaufempfehlungen beim Online-Shopping gewöhnt und nutzen ständig Suchmaschinen. Auch aus Alltagsdaten könnten sensible Informationen über Personen gewonnen werden. So etwa von einer Supermarktkette, die aus dem veränderten Einkaufsverhalten einer Kundin eine Schwangerschaft ableite oder aus Bewegungsdaten einer Person auf Depressionen schliesse. Diese möglichen Probleme von «Big Data» zu verstehen sei wichtig, um auf die Zukunft vorbereitet zu sein, erklärten die Forscher nun im Schlussbericht. Denn die Regulierung stecke noch in den Kinderschuhen und hinke der technologischen Entwicklung hinterher. «Big Data» spiele allerdings schon heute eine grosse Rolle im täglichen Leben, so Eisenbrand: «Wir haben uns an erstaunlich genaue Kaufempfehlungen beim Online-Shopping gewöhnt und nutzen ständig Suchmaschinen.» Als weiteres Beispiel führte Eisenbrand die Gesundheitsdaten an. So produziere ein modernes Schweizer Spital monatlich ein Petabyte an Daten, was einer Milliarde Bücher entspreche. Die British Library als weltgrösste Bibliothek führe zum Vergleich etwa zehn Millionen Bücher.
● Der Brand eines Gebäudekomplexes mit Käselager vom Donnerstag in Vuisternens-en-Ogoz FR hat 11’000 Laibe Greyerzerkäse zerstört. Ebenfalls betroffen ist ein Verpackungsunternehmen, das 24 Angestellte vorübergehend nicht mehr beschäftigen kann. Laut einem Vertreter der Firma Mifroma gehören 6000 der zerstörten Käselaibe diesem Unternehmen, das unter dem Dach der Migros-Gruppe geschäftet. Die Versorgung der Migros mit Greyerzer sei gesichert, sagte der Vertreter. Besitzer der weiteren zerstörten 5000 Käselaibe sind andere Käsereien. Greyerzer, auch Gruyère genannt, ist ein Schweizer Hartkäse aus der Rohmilch von Kühen. Im Jahr 2016 wurden 29’136 Tonnen Gruyère verkauft, davon rund 14’900 Tonnen in der Schweiz. Die Käseherstellung lässt sich im Greyerzerland bis in das Jahr 1115 zurückverfolgen. Gemeint war damit der um das Freiburger Städtchen Greyerz hergestellte Käse. In den USA ist die Bezeichnung Gruyère nicht geschützt und daher auch rechtlich nicht an die Herkunft geknüpft.
● Während sich der Mensch im 19. Jahrhundert mehr ausbreitete und den Wald für sich nutzte, verschwanden Wildtiere: Vom Fischotter bis zum Wildschwein – die Liste der Tiere, die zeitweise keinen Lebensraum fanden, ist lang. Seit Jahrzehnten bemühen sich Forscher, das zu ändern. Mit Erfolg wieder angesiedelt wurde der Bartgeier. Etwa 350 Geier leben heute im Alpenraum. Biologen verfolgen seit 30 Jahren, wie sich die Population verändert. Ein immenser Aufwand. Und es gibt Probleme: Bereits drei Jungvögel können nicht fliegen. Ihre Federn sind fehlgebildet, den Flügeln fehlt die Tragfläche. Biologe Daniel Hegglin von «Pro Bartgeier» sorgt sich: «Die Tiere sind im Schnitt näher verwandt, es gibt Inzuchtrisiken.» Um den Genpool besser zu durchmischen, versuchen europäische Forscher neue Geier anzulocken und streuen dafür Futter von den Pyrenäen bis in die Schweizer Alpen. Für Hegglin eine moralische Frage: «Wir haben diese Art ausgelöscht und jetzt die Chance, wenn wir das für richtig halten, sie wieder zurückzubringen.» Ein Eingriff sei es so oder so, egal ob der Mensch handle oder nicht. Ohne aktives Handeln gäbe es auch den Luchs nicht mehr. In den 1970ern haben ihn Forscher aktiv angesiedelt. Heute gibt es 260 Luchse. Doch auch sie haben Genprobleme. Strassen und Siedlungen durchschneiden ihren Lebensraum – die Luchse können sich nicht durchmischen. «Wir sitzen auf einem Pulverfass», sagt Biologin Christine Breitenmoser von der Wildtierstiftung KORA. Damit Luchse langfristig in Europa leben können, brauchen sie Hilfe. Einerseits durch Zoos: Vom Tierpark Dählhölzli könnten Nachkommen eines Luchspaars aus Tschechien in der Schweiz ausgewildert werden. Andererseits durch Korridore, dank denen die Raubkatzen unbegrenzt wandern könnten. Der Rothirsch gehört zu den Wildtieren, die von alleine zurückgekehrt sind, nach Einführen des Jagdgesetzes 1875. Jetzt gibt es etwa 40’000 Hirsche in der Schweiz. Und es werden immer mehr. Im Vergleich zu den Alpenkantonen ist das Mittelland dicht besiedelt. «Was mich sehr fasziniert ist, dass der Rothirsch seine Lebensräume selber recht gut erschliessen kann», sagt ZHAW-Forscher Signer. Die Hirsche hätten ihren Rhythmus an den Menschen angepasst und seien jetzt nachtaktiv, um in den Morgenstunden ungestört in Siedlungsnähe fressen zu können: «Das ist eine extreme Verhaltensänderung.» Auch andere Tiere kommen von sich aus zurück, wie der Fischotter oder der Wolf. Das führt auch zu Konflikten, wie viel Raum der Wolf einnehmen darf, wird schon länger diskutiert.
● Ein Meilenstein für weibliche Armeeangehörige. Vor 30 Jahren starteten Männer und Frauen erstmals gemeinsam in die Rekrutenschule. Ein wichtiger Integrationsschritt.
● In den Bahnhöfen und Zügen wurden mehr Videokameras installiert. Gemäss SBB bewegt man sich im rechtlichen Rahmen.
● Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für 2022 einen definitiven Verlust von 132.5 Milliarden Franken aus. Im Jahr 2021 hatte noch ein Gewinn von 26.3 Milliarden resultiert. Der Verlust auf den Fremdwährungspositionen betrug dabei 131.5 Milliarden und derjenige auf den Frankenpositionen 1.0 Milliarden Franken. Auf dem Goldbestand resultierte derweil ein Bewertungsgewinn von 0.4 Milliarden Franken, wie die SNB mitteilte. Wegen des hohen Verlustes gehen – wie ebenfalls bereits bekannt – Bund und Kantone leer aus. Eine Dividende an die Aktionäre – üblicherweise sind es 15 Franken pro Aktie – wird ebenfalls nicht ausbezahlt. Die Nationalbank hat ausserdem die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 9.6 Milliarden Franken festgelegt. Nach Berücksichtigung der vorhandenen Ausschüttungsreserve von 102.5 Milliarden Franken resultiert somit ein Bilanzverlust von 39.5 Milliarden.
● Bei der UBS hat Ralph Hamers in seinem zweiten vollständigen Jahr als CEO der Grossbank 12.6 Millionen Franken verdient. Im Jahr davor waren es 11.5 Millionen gewesen. Hamers hatte am 1. September 2020 bei der UBS begonnen und das Amt des CEO am 1. November übernommen. Von den 12.6 Millionen Franken machen 2.9 Millionen das Fixgehalt aus und 9.7 Millionen den variablen Teil des Lohns. An die gesamte Geschäftsleitung der grössten Schweizer Bank wurden 2022 total 106.9 Millionen ausbezahlt, im Vergleich zu 107.8 Millionen Franken im Jahr davor.
● Die beliebten Kinderbücher des britischen Schriftstellers Roald Dahl sorgen derzeit für Aufruhr in der Literaturwelt: Einige seiner Werke, darunter «Charlie und die Schokoladenfabrik», «Matilda» und «Hexen hexen», wurden von einem englischen Verlag sprachlich stark angepasst: statt «fett» schreiben sie «umfangreich», statt «winzig» ist von «klein» die Rede. Man habe zudem auch genderneutrale Umformulierungen vorgenommen, um sensibilisierte Lesende zu berücksichtigen, erklärte der Verlag. Für viele Bücher waren Skandale und Verbote zugleich beste Werbung: Goethes «Werther» etwa, Gustave Flauberts «Madame Bovary» oder «Doktor Schiwago» von Boris Pasternak. Sie alle gehören heute zum literarischen Kanon. Die Praxis des Bücherverbots hat bis heute Bestand: Die «Harry Potter»-Bände wurden mancherorts aus Schulbibliotheken verbannt – wegen teuflischer Magie. Von Bücherverboten in der Gegenwart zeugt auch der Roman «Die satanischen Verse» von Salman Rushdie. Viele der Verbote und Ächtungen, die das Literaturmuseum thematisiert, erscheinen uns aus heutiger Perspektive absurd. Gleichzeitig steckt unsere Gesellschaft mit der sogenannten Cancel Culture selbst mitten in einer Zensurdebatte. Eingriffe in literarische Texte wie «Jim Knopf», «Pippi Langstrumpf» oder zuletzt bei Roald Dahls Kinderbüchern erachten manche als moralische Verpflichtung. Die Ausstellung «Satanische Verse & verbotene Bücher» ist noch bis zum 21. Mai im Zürcher Literaturmuseum «Strauhof» zu sehen. Di-Fr 12–18 Uhr | Do 12–22 Uhr | Sa-So 11–17 Uhr, Augustinergasse 9, +41 44 221 93 51, (strauhof.ch). 10 CHF Eintritt.
● Waffen, Panzer und Munition. 955 Millionen: Schweiz führt so viel Kriegsmaterial aus wie nie. Der Grossteil der Rüstungsgüter aus der Schweiz ging an Katar, Dänemark, Deutschland, Saudi-Arabien und die USA.
● Vorsicht bei Online-Bestellung. Hohe Versandkosten beim Internethändler Fruugo. Knapp 100 Franken Lieferkosten bei einer Bestellung von 60 Franken. SRF.ch
Ukraine – Zwei Tage nach Beginn der russischen Invasion wählt Michailo Fedorow die Nummer von Elon Musk. Das Gesprächsthema zwischen dem ukrainischen Vizepremierminister und dem Twitter-Chef: Starlink, ein weltweit betriebenes Satellitennetzwerk des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX, dessen Inhaber ebenfalls Elon Musk ist. Damals legten Fedorow, der auch als ukrainischer Digitalminister amtiert, und der Multimilliardär Musk den Grundstein für eine digitale Infrastruktur, welche für die Ukraine in diesem Krieg inzwischen entscheidend geworden ist: die Nutzung von Starlink. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland gleicht nach wie vor dem Kampf David gegen Goliath. Dort das riesige russische Reich, das mit grossflächigen, aber unpräzisen Artilleriebeschüssen die Ukraine in Schutt und Asche legt. Hier die vom Westen unterstützte Ukraine, welche das russische Waffenarsenal quantitativ nicht spiegeln kann und daher auf Effizienz setzen muss. Und genau hier wird offensichtlich, weshalb Starlink für die Ukraine inzwischen so entscheidend geworden ist. Denn das Satellitennetzwerk ermöglicht genau diese Effizienz, welche Kiew braucht, um über die Rolle als David hinauszuwachsen. Oder wie es Stefan Soesanto formuliert: «Starlink ist das Rückgrat der ukrainischen Armee.» «Die Ukraine arbeitet mit dem Programm Delta. Dieses ermöglicht der Armee, in Echtzeit russische Truppenbewegungen zu verfolgen.» Die Ansicht sei ähnlich wie diejenige auf Google Maps, erklärt Soesanto, jeder ukrainische Kommandant habe Zugriff auf das System. Soweit die ukrainische Innovation. Doch Delta, und hier macht Soesanto einen Punkt, könne für sich alleine seine Funktionen nicht ausspielen; denn die «Kommunikation läuft über Starlink», erklärt er. Beobachten also ukrainische Befehlshaber auf ihren Tablets die russischen Truppenbewegungen und stützen darauf ihre strategischen Entscheidungen, sind sie auf Starlink angewiesen. Doch damit nicht genug, denn Starlink nimmt auch bei Drohnenattacken eine elementare Rolle ein. Soesanto sagt: «Die Ukraine braucht Starlink, um ihre Drohnen zu kontrollieren.» Weil ausserdem die Kameras in den Städten mit Starlink verbunden werden können, sei die Technologie auch bei Strassengefechten, wie sie beispielsweise gerade in der umkämpften Stadt Bachmut stattfinden, ein entscheidender Faktor. Laut Elon Musk sind in der Ukraine etwa 25’000 Starlinkterminals im Einsatz. Die Wichtigkeit der Technologie für die ukrainische Verteidigung kann, wie Soesanto ausgeführt hat, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch bei der Nutzung von Starlink in der Ukraine zeigt Musk unberechenbare Tendenzen. So machte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell zuletzt Andeutungen, den Dienst zurückzufahren: «Starlink war nie dazu gedacht, als Waffe eingesetzt zu werden.» Weil die Ukraine Starlink für Drohnenangriffe braucht, wirft SpaceX der Regierung von Wladimir Selenski also Vertragsbruch vor. Für Cyberexperte Soesanto ist dies aber vor allem ein Anzeichen dafür, dass die Ukraine die SpaceX-Verantwortlichen auf dem falschen Fuss erwischt hat: «Musk hat den Erfindergeist der Ukraine unterschätzt.»
● Rheinmetall möchte eine grosse Panzerfabrik in der Ukraine bauen. Diese könnte jährlich 400 Kampfpanzer vom Typ Panther produzieren, sagte Unternehmenschef Armin Papperger. „Für rund 200 Millionen Euro kann ein Rheinmetall-Werk in der Ukraine aufgebaut werden“. Rheinmetall hat seit Kriegsbeginn nach eigenen Angaben 1200 neue Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt hat das Unternehmen weltweit rund 30’000 Beschäftigte, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat sich seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges vor gut einem Jahr fast verdoppelt, das Unternehmen ist an der Börse fast elf Milliarden Euro wert. Russland droht mit sofortiger Zerstörung einer solchen Fabrik. SRF.ch
● Kiew zieht Truppen vor der Grenze Transnistriens zusammen. VESTI.ru
UNO – Die Vereinten Nationen erzieen Durchbruch bei Hochseeabkommen. Die UNO-Mitgliedsstaaten wollen die Meere und die dortige Biodiversität besser schützen. SRF.ch
USA – „Biden hat ein Zeitfenster zwischen jetzt und spätestens November 2024“, sagt der Politologe Jackson Janes beim German Marshall Fund in Washington. Er kennt sowohl die deutsche als auch die amerikanische Politik in- und auswendig. «Im kommenden Präsidentschaftswahlkampf wird die Ukraine-Hilfe ein Hauptthema sein. Also wird Biden Erfolge vorweisen müssen. Falls nicht, wird es für ihn schwierig, die amerikanische Öffentlichkeit von seiner Ukraine-Politik zu überzeugen.» Kürzlich zeigte zum ersten Mal seit Beginn des Krieges eine der in den USA so wichtigen Meinungsumfragen keine Zustimmung zu Bidens Ukraine-Politik.
● Rafael Viñoly, 1944 in Montevideo geboren, hinterlässt über 600 Werke auf der ganzen Welt. Darunter finden sich Hotels, Konzertsäle, Stadien und andere Infrastrukturen: etwa die kreisförmige Brücke über die Lagune von Garzon im Osten von Uruguays Hauptstadt Montevideo. Auch der englische Fussballclub Manchester City, für den Viñoly das Trainingszentrum «City Football Academy» konzipiert hatte, würdigte ihn. Einige von Rafael Viñoly Projekten waren jedoch umstritten. Bewohner des 426 Meter hohen und extrem schmalen Luxushochhaus an der Park Avenue in Manhattan klagten über Lärmemissionen und Erschütterungen, die besonders bei starkem Wind auftreten. Dann soll auch der Lift stundenlang ausfallen. In der Londoner City machte 2013 Rafael Viñolys Wolkenkratzer mit dem Spitznamen «The Walkie-Talkie» Schlagzeilen, im Volksmund auch «Rasierapparat» genannt. Die Reflexion der Sonnenstrahlen auf der gebogenen Glasfassade hatte einen vor dem Haus geparkten Jaguar beschädigt. Rafael Viñoly starb im Alter von 78 Jahren in New York. SRF.ch
Zentralafrikanische Republik – Die Zentralafrikanische Republik will zum Krypto-Eldorado Afrikas werden. Doch Investoren sind skeptisch. SRF.ch

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.



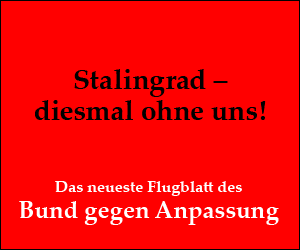



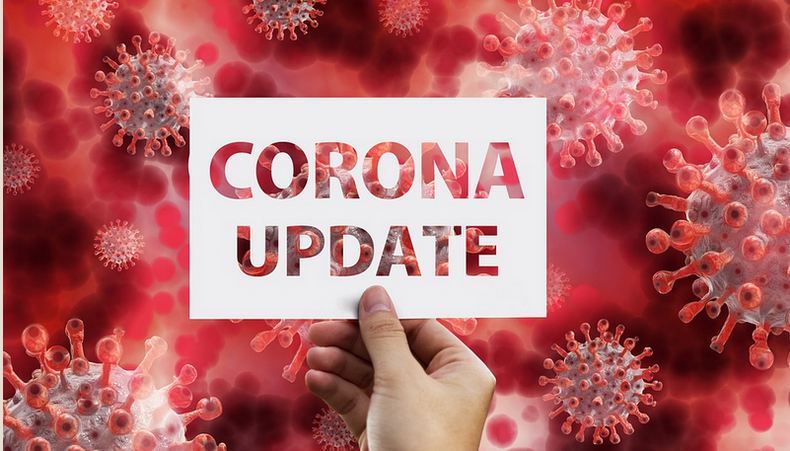




“Argentinien ‑Die Stadt Buenos Aires setzt auf Gesichtserkennung”
Und andernorts ist man auch nicht mehr sicher: “In den Bahnhöfen und Zügen wurden mehr Videokameras installiert”
Auch auf den urlaubsbeliebten Kanaren nicht: https://infos-grancanaria.com/2022/der-las-canteras-strand-ist-der-erste-strand-mit-vollueberwachung-aller-daten/
“Deutsche suchen die teuerste Gurke”:
Da sollten sie lieber mal im Bundestag der Grünbananenrepublik suchen, da gibts jede Menge Gurken die uns jede Sekunde mehr als 3,29 kosten
“Rumänien – Der Handel mit illegal geschlagenem Holz gilt mittlerweile als eine der Haupteinnahmen der organisierten Kriminalität”:
Und wo bleiben mal wieder die Klimakleber und Antifäserant_0-9A-Z#*Innen?
“Wir haben uns an erstaunlich genaue Kaufempfehlungen beim Online-Shopping gewöhnt und nutzen ständig Suchmaschinen”:
Anders gesagt: Die Masse hat sich schon daran gewöhnt den vorgesetzten maschinengenerierten Fraß zu schlucken und hat auch sonst das eigenständige Denken aufgegeben.