Im Internetradio mitgehört und mitgeschrieben von Wilhelm Tell
Ägypten – Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat im Gegensatz zu früheren Äußerungen erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebt. „Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien“, sagte Lawrow heute in Kairo. Das russische und das ukrainische Volk würden künftig zusammenleben. ORF.at
Arktis – Die Lebensräume der arktischen Wale werden sich bis zum Ende des Jahrhunderts knapp 250 Kilometer nach Norden verschieben: Das prognostiziert ein internationales Forschungsteam. Die Tiere müssen auf die steigenden Wassertemperaturen reagieren – bleiben aber auch weiter nördlich von menschlichen Aktivitäten beeinträchtigt. ORF.at
Aserbaidschan – EU-Deal: Türkische Zustimmung für erhöhte Gaslieferungen nötig. Klauseln im TANAP-Abkommen zwischen Ankara und Baku räumen Türkei bei Kapazitätserweiterungen Vorrang ein. Mit Blick auf den jüngsten Gasdeal zwischen der EU und Aserbaidschan muss demnach auch die Türkei einer Änderung der Liefermengen zustimmen. TRT.tr
Bulgarien – Klimawandel und Waffenindustrie (für Ukraine) gefährden Rosenölproduktion. EU Unterstützung wird eingefordert. SRF.ch
Deutschland – Im deutschen Bahn-Nahverkehr kostet ein Ticket derzeit neun Euro – für einen Monat. Das schadet vielen Busunternehmen.
●Moses als Magier und Salomon als Dämonen-Bezwinger. Erstmals auf Deutsch erschienen: Eine jüdische Legendensammlung zeigt die magischen Seiten des Alten Testaments. Ein Rabbi ersteht ein silbernes Kästchen, in dem ein Frosch haust. Er füttert ihn so lange, bis der Frosch alles verzehrt hat, was der Rabbi besitzt. Da gewährt ihm der Frosch einen Wunsch: «Ich begehre weiter nichts von dir, bloss, dass du mich die ganze Torah lehrst.» Wären da nicht die jüdischen Begriffe – die Geschichte könnte glatt als Grimm’sches Märchen durchgehen. Es ist eine der jüdischen Legenden, die der jüdische Gelehrte Louis Ginzberg (1873-1953) gesammelt hat. Diese sind nun unter dem Titel «Legenden der Juden» erstmals auf Deutsch erschienen. Darin entpuppt sich Moses als grosser Magier und Salomon als Dämonenbezwinger. Und David ist zwar immer noch unerschrocken, Goliath besiegt er allerdings nur dank übernatürlicher Hilfe. Wäre das Alte Testament ein Spielfilm, so wären die jüdischen Legenden wohl die Fantasyserie dazu. Diese Legenden stellen unser Verständnis des Alten Testaments gehörig auf den Kopf. «Die jüdische Legendenliteratur, die Aggada, ist durchaus rebellisch», sagt Andreas Kilcher, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich. Er hat die «Legenden der Juden» gemeinsam mit Joanna Nowotny erstmals auf Deutsch herausgegeben. «Die Legendenliteratur stellt nämlich Aspekte in den Vordergrund, die in der Bibel entweder ausgeblendet oder sogar negativ erwähnt sind», erklärt er. «Zum Beispiel die Astrologie – denn dies würde ja bedeuten, dass es neben Gott noch andere Mächte gibt, die unser Schicksal bestimmen.» Das andere, was die Bibel ausblendet, sei die Magie und das magische Denken. In den jüdischen Legenden gebe es tatsächlich weitere solcher Mächte, erklärt Andreas Kilcher: «Gott hat eine Vielzahl von Agenten: Engel, Sterne, Dämonen.» Sie alle hätten ihren Platz im grossen göttlichen Plan. Gott bleibe zwar der Chef. «Aber keiner, der nicht zulassen würde, dass in seinem Haus sehr viel passiert.» Gesammelt hat die Legenden Louis Ginzberg, ein jüdischer Gelehrter aus dem russischen Zarenreich. Er ist eine Art jüdischer Bruder Grimm. Anders als die Gebrüder Grimm hat er die Legenden jedoch nicht mündlich bei der Bevölkerung gesammelt. Vielmehr hat er akribisch alles zusammengetragen, was er in Bibliotheken, Archiven und bei Gelehrten finden konnte. Aus diesen Mosaiksteinen hat er dann die Geschichten konstruiert, sie neu erzählt. Dabei bewies er literarische Qualitäten. Er arbeitete mit Motiven, Symbolik und Wiederholungen und setzte dramaturgisch geschickte Erzählbögen. Ginzberg war offensichtlich in der Literatur der europäischen Volksmärchen bewandert und kannte auch die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Das ist nicht verwunderlich, denn Ginzberg sprach Deutsch. Geboren wurde er 1873 im russischen Kowno, auf dem Gebiet des heutigen Litauen. Danach studierte er im Deutschen Kaiserreich. Dass aus ihm später ein jüdischer Talmudgelehrter werden sollte, hört sich selbst fast an wie eine Legende. Ginzberg stammte aus einer religiösen Familie und war mütterlicherseits mit einem bedeutenden jüdischen Gelehrten verwandt, dem Gaon von Wilna. Dieser hatte das Judentum Mitte des 18. Jahrhunderts mit seinen Auslegungen geprägt. «In der Familie erzählte man sich, dass ein Nachkomme des Gaon sein Nachfolger werde», erzählt Ginzbergs Enkel David Gould, ein 77-jähriger New Yorker. «Dieser werde strahlend blaue Augen haben.» Solch auffallend blaue Augen, wie sie Ginzberg gehabt habe, der bereits als Kind durch seine Intelligenz aufgefallen sei. Sein Weg zum grossen Gelehrten verlief allerdings nicht geradlinig. Zwar doktorierte er an der Universität Heidelberg. «Doch als Jude hätte er im Deutschen Kaiserreich wohl kaum eine Anstellung an einer Universität gefunden», erzählt der Enkel. Grund war der weit verbreitete Antisemitismus Ende des 19. Jahrhunderts, mit Pogromen auf dem heutigen Gebiet Russlands und der Ukraine und Einschränkungen in deutschen Städten. Als Louis Ginzberg 1899 eine Einladung in die USA erhielt, nahm er sie sofort an. Er ging ans renommierte Jewish Theological Seminary in New York, der führenden Institution für die Ausbildung von Rabbinern in den USA. Dort wurde er zu einer der prägenden Figuren des konservativen Judentums. Die Legenden sammelte er seit seiner Dissertation in Heidelberg. Damals habe er vermutlich Feuer gefangen. «Mein Grossvater war ein begnadeter Geschichtenerzähler», erinnert sich Enkel Gould. In den folgenden 30 Jahren schrieb der Gelehrte Hunderte von Legenden nieder. Legenden, wie jene, in der sich die Buchstaben des hebräischen Alphabets bei Gott darum bewerben, die Schöpfungsgeschichte zu beginnen. Oder jene, in der Gott nicht nur einen Himmel und eine Erde erschafft, sondern gleich deren sieben. Das verleiht dem Ausspruch, sich wie im siebten Himmel zu fühlen, einen ganz neuen Sinn. Denn in ihm wohnt das Gute und Schöne, und steht Gottes Thron. «Gerade diese Legenden sind ein Beispiel dafür, wie knapp die biblische Erzählung von der Schöpfung eigentlich ist», erklärt Literaturwissenschaftler Kilcher. «Die jüdische Legendenliteratur schmückt sie aus, entwickelt eine eigene Kosmologie.» Die Legenden der Juden sprengen bisherige Vorstellungen. «Das Charakteristikum dieser Legenden ist, dass sie ein Element stark machen, das die Bibel herauszuhalten versucht: die Magie, aber auch das Alltägliche, das mit der Magie verbunden ist, etwa die Heilung von Krankheiten oder das Finden von Liebe.» Dass das Judentum dermassen magisch aufgeladen ist, überrascht. Allerdings nur aus heutiger Perspektive. «Wir haben ein modernes Bild des Judentums», so Kilcher. «Während der Aufklärung haben jüdische Philosophen wie Moses Mendelssohn und andere das Judentum als rationale Religion positioniert.» Die modernen jüdischen Denker hätten die Vernunft betont und das magische und mystische Element aus dem Judentum gestrichen. «Sie sagten, das sei Götzendienst, das sei unrein, mit dem wollen wir uns nicht identifizieren.» Doch die Legenden zeigen ein völlig anderes Bild: «Dass nämlich das Magische und Mystische zum Judentum gehört hat und gehört.» Ginzbergs «Legenden der Juden» bringen das Magische zurück ins Judentum. Dass diese Legenden erst jetzt im deutschen Original zu lesen sind, ist eine historische Pointe. In den USA, wo Ginzberg lebte, erschienen sie bis 1930 in englischer Übersetzung. Deswegen sind sie in englischsprachigen jüdischen Familien bekannt. Anders im deutschsprachigen Raum: Während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs war eine Publikation in der Originalsprache nicht möglich. Danach hat sich niemand mehr darum gekümmert. Bis heute. Sie mussten fast 90 Jahre warten, um wachgeküsst zu werden – wie der Frosch im Grimm’schen Märchen. Der Frosch in den jüdischen Legenden ist allerdings kein verzauberter Prinz, sondern entpuppt sich als Adams Sohn. Gezeugt mit Lilith, der ersten Frau Adams mit dämonischen Wurzeln. Deshalb könne er jede Gestalt annehmen, die ihm beliebt. Er ist also ein Gestaltwandler. Und damit eine typische Fantasyfigur. In der Welt der «Legenden der Juden» von Louis Ginzberg hätte sich dementsprechend wohl auch Harry Potter und Co. zu Hause gefühlt. Louis Ginzberg: «Die Legenden der Juden». Herausgegeben von Andreas Kilcher und Joanna Nowotny. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2022. 1’499 Seiten, €58, 978-3-633-54312-0. SRF.ch
China – Die USA und EU müssen den Frieden in der Ukraine fördern und Russland nicht als Terrorstaat abstempeln, sagt China. CGTN.cn
Frankreich – Die Abgeordnete wollen Rundfunkgebühr abschaffen. Die Mehrheit der Nationalversammlung ist für die Abschaffung der Gebühren für öffentliche Radio- und TV-Sender. SRF.ch
Iran – Im Iran hat es schwere Überschwemmungen gegeben. Dabei sind nach Angaben des Gouverneurs der Stadt Estahban mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Nach heftigen Regenfällen ist ein Fluss über die Ufer getreten. Der Iran war in den vergangenen zehn Jahren schon mehrfach von Überschwemmungen betroffen. RBB.de
Großbritannien – Stau am Ärmelkanal. 20 Stunden Wartezeit in Dover – dem «Hotspot der Ferienhölle» Stundenlanges Warten an der Grenze: So stellt man sich den Ferienstart nicht vor. Für Zehntausende wurde das Realität. SRF.ch
Israel – Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte zuletzt erklärt, das Vorgehen des Justizministeriums gegen die Organisation hänge mit Verstößen gegen russische Gesetze zusammen. Er wies Spekulationen zurück, dass Moskau damit verhindern wolle, dass noch mehr „kluge Köpfe“ aus Russland nach Israel abwandern. Nach Angaben des israelischen Integrationsministeriums haben heuer knapp 17.000 Menschen Russland in Richtung Israel verlassen – mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. In Israel ist man indes davon überzeugt, dass Moskau mit dem Verbot der Jewish Agency for Israel das Land für dessen Haltung im Ukraine-Krieg bestrafen will. Die israelische Regierung hat den Angriff Russlands verurteilt und seine Solidarität mit der Ukraine erklärt. ORF.at
Japan – Die Entsorgung von nuklear kontaminiertem Wasser in Fukushima könnte die globale Meeresumwelt und die öffentliche Gesundheit der pazifischen Anrainerstaaten beeinträchtigen. Es ist keineswegs eine Privatangelegenheit für Japan. Die chinesische Seite fordert die japanische Seite erneut dringend auf, ihre fälligen internationalen Verpflichtungen ernsthaft zu erfüllen, das nuklear kontaminierte Wasser auf wissenschaftlich fundierte, offene, transparente und sichere Weise zu entsorgen und den Plan zur Einleitung des Wassers in den Ozean nicht mehr durchzusetzen. „, sagte er. „Wenn Japan darauf besteht, seine eigenen Interessen über das öffentliche Interesse der internationalen Gemeinschaft zu stellen, und darauf besteht, den gefährlichen Schritt zu unternehmen, wird es sicherlich den Preis für sein unverantwortliches Verhalten zahlen und einen Fleck in der Geschichte hinterlassen“, sagte er. Als Reaktion auf die offizielle Genehmigung des Plans durch die Aufsichtsbehörde berief die südkoreanische Regierung eine Sondersitzung ein und erklärte, sie werde „intern und extern die bestmöglichen Maßnahmen ergreifen“ unter dem Grundsatz, dass die Gesundheit und Sicherheit der Menschen von größter Bedeutung sind trotz sengender Hitze auf den Straßen, um gegen die Genehmigung zu protestieren Einige Demonstranten benutzten Megaphone, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken, während andere Transparente mit der Warnung vor Radioa hochhielten Aktivität im Werk. Das Kraftwerk Fukushima wurde durch das schwere Erdbeben und den Tsunami im Jahr 2011 beschädigt, die Kernschmelzen in mehreren Kernreaktoren verursachten. Wasser, das kontaminiert wurde, nachdem es hineingepumpt wurde, um den geschmolzenen Brennstoff kühl zu halten, hat sich in dem Komplex angesammelt und sich auch mit Regenwasser und Grundwasser am Standort vermischt. CGTN.cn
Kanada – Misshandlung indigener Kinder. Papst in Kanada: Eine Entschuldigung ist nicht genug. In Kanada wurden Indigene misshandelt, Papst Franziskus will sich entschuldigen. Vielen Ureinwohnern reicht das nicht. SRF.ch
Kuba – Der kubanische Präsident hat von seinen Landsleuten angesichts der aktuellen Wirtschaftsprobleme „Geduld“ eingefordert. Es gebe keine „sofortige“ Lösung für die derzeitigen Probleme, sagte Diaz-Canel gestern bei einer Sondersitzung des Parlaments in Havanna. In mehreren Ortschaften hatte es zuletzt Demonstrationen wegen wiederholter Stromausfälle gegeben. Die Situation werde von einigen Mitbürgern und Mitbürgerinnen genutzt, um „die Revolution anzugreifen“, sagte Diaz-Canel. Andere beteiligten sich an „Vandalismus“, würden Steine werfen und Fenster einschlagen. Wer so handle, entspreche den Erwartungen der Verfechter „der Gegenrevolution und der Blockade“, sagte der Präsident. Damit bezog er sich auf die von den USA verhängte Blockade. ORF.at
Niederlande – Der Aldi-Supermarkt im House Modernes – an der Kreuzung Lange Viestraat und Oudegracht in Utrecht – wird am 27.7. eröffnet. Nicht irgendein Supermarkt, dieser Aldi ist der erste komplett kassenlose Supermarkt. Beim Betreten und Verlassen des Ladens muss ein QR-Code gescannt werden und mittels sehr vielen Kameras und Sensoren wird registriert, was Kunden in ihre Tasche stecken. Jan Oostvogels, CEO von Aldi in den Niederlanden, sagt, dass die Eröffnung des Geschäfts die nächste Phase in der Entwicklung des Systems sei. „Kassenloses Einkaufen ist hundertfach erprobt und die Kinderkrankheiten sollten weg sein. Jetzt, da Kunden in den Laden kommen, wird das dazu beitragen, das System noch weiter zu verbessern.“ Das System arbeite auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Privatsphäre der Kunden hat höchste Priorität. Sobald der Kunde auscheckt, wird nichts von den Daten gespeichert. Der Datenschutz musste vor der Eröffnung wirklich zu 100 Prozent geregelt werden.“ Alles im Supermarkt funktioniert automatisch, bis auf die Altersprüfung beim Alkoholkauf. Diese Produkte werden in einer separaten Abteilung platziert. Bevor ein Kunde dort hineingeht, führt ein Mitarbeiter eine Altersprüfung durch. Kunden, die beim kassenlosen Aldi einkaufen wollen, müssen eine App herunterladen. Diese App fragt nach Ihrer E-Mail-Adresse und Kreditkarteninformationen und zeigt dann einen QR-Code an. Sie scannen es, wenn Sie den Laden betreten, woraufhin sich ein Tor öffnet. Das System gibt Ihnen eine digitale Nummer und verfolgt dann Ihre Bewegungen. Insgesamt sind 475 Kameras im Laden, die registrieren, welche Produkte ein Kunde mitnimmt. Alle Produkte stehen in den Regalen auf einer Waage, die auch registriert, was abgenommen wird. Diese doppelte Überprüfung sollte Fehler verhindern. Beim Verlassen des Ladens scannen die Kunden den QR-Code erneut vor einem Tor. Die mitgeführten Produkte werden dann automatisch von Ihrer Kreditkarte abgebucht. Die Quittung für Ihren Einkauf wird Ihnen per E-Mail zugesendet. Die Tatsache, dass Sie nicht mehr an der Kasse vorbeigehen, bedeutet nicht, dass kein Personal mehr im Laden ist. Regale werden aufgefüllt und Brot wird frisch gebacken. Flächenmäßig ist der Markt etwa ein Drittel so groß wie ein durchschnittlicher Aldi. Indem die Produkte weniger breit präsentiert werden, ist das Angebot fast genauso groß. Derzeit sind keine Non-Food-Produkte erhältlich. Der Pfandautomat ist an das System angeschlossen. ●Ein paar neugeborene Spitzenhaie wurden letzte Woche in der Nähe von Terschelling und Ameland gefunden. Das Wattenmeer ist ein Nährboden für diese Art. Der Hai mit seiner spitzen Schnauze kann bis zu zwei Meter lang werden und frisst hauptsächlich Fisch und Hummer. Die Art steht weltweit unter erheblichem Druck. NPO.nl
Nordirland – trotz wirtschaftlichem Erfolg staut sich die Wut. Beim Brexit war allen klar, um den Frieden in Nordirland nicht zu gefährden, darf zwischen Nordirland und Irland keine harte Grenze entstehen. Nordirland blieb deshalb im EU-Binnenmarkt. Diese Entscheidung lässt jetzt aber die Emotionen hochgehen, insbesondere bei den protestantischen Unionisten. Beide Seiten haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, die Regierung von Boris Johnson in London und die Europäische Union: Nordirland bleibt im EU-Binnenmarkt. Das hat den Vorteil, dass sich Menschen und Güter weiterhin völlig ungehindert zwischen dem Norden der Insel und der Republik Irland hin und her bewegen können. Es hat aber den Nachteil, dass es jetzt in der Irischen See eine Zollgrenze gibt, die Nordirland vom britischen Mutterland trennt. Die protestantischen Unionisten fühlen sich deshalb verraten und sehen ihre britische Identität in Gefahr. Immer wieder führt die Frustration zu Protesten, wiederholt schon zu Gewalt. Busse und Autos brannten. Steine und Flaschen flogen. Die Emotionen gehen hoch, obwohl die Unternehmen in Nordirland zufrieden sind mit der neuen Lösung. Seit dem Brexit floriert das Geschäft nämlich in beide Richtungen, zum Süden der Insel hin und – trotz der neuen Zollgrenze in der Irischen See – zum Mutterland auf der anderen Seite. Warum sind Fragen der Identität wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Reportage aus Nordirland. „International“ SRF.ch
Norwegen – Die Stimmung auf Spitzbergen war auch schon besser. Das von Norwegen verwaltete Spitzbergen gerät zunehmend in den Strudel des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Nicht nur in der Vergangenheit geschlossene Verträge werden infrage gestellt, auch die dort lebenden Menschen geraten unter Druck. Gut 3000 Menschen leben in Spitzbergen auf einer Fläche von über 60’000 Quadratkilometern. Sie kommen aus über hundert verschiedenen Staaten. Heute dominieren die Forschung und der Tourismus das Leben im nördlichsten von Menschen bewohnten Gebiet der Welt. Von der Sowjetunion, die sich 1991 auflöste, bleibt auf Spitzbergen bis heute die Bergbaustadt Barentsburg, die hauptsächlich aus ukrainischen Mineuren und ihren Familien sowie russischen Verwaltungsangestellten besteht. Insgesamt sind es gut 500 Menschen. «Wir haben über die Jahre hier auf der Insel enge Beziehungen zwischen den Siedlungen aufgebaut», sagt Vigdis Jensen, die seit zehn Jahren auf Spitzbergen lebt. Sie organisiert jedes Frühjahr das grosse Sonnenfest, das nach der fast vier Monate dauernden Polarnacht gefeiert wird. Im Nachzug zum russischen Angriff auf die Ukraine sind nun aber die traditionell engen Beziehungen zwischen den russischen und norwegischen Siedlungen weitgehend eingefroren worden. Norwegen hat die Grenzkontrollen bei der Ein- und Ausreise von und nach Spitzbergen über den einzigen internationalen Flughafen in Longyearbyen verstärkt. Russland seinerseits stellt ein wichtiges Grenzabkommen mit Norwegen in der Barentssee infrage. Dazu gehört der Transport von Nahrungsmitteln und anderen Versorgungsgütern aus Russland nach Barentsburg. Statt diese direkt per Schiff in die Hocharktis zu bringen, schickte Moskau Anfang Juli mehrere Sattelschlepper in Richtung Norwegen, um auf diesem Weg das auch von Norwegen verhängte Sanktionsregime herauszufordern. Prompt blieben die Waren am Zoll in Nordnorwegen stecken, worauf Russland dies als Bruch des Spitzbergen-Abkommens bezeichnete. Erst der direkte Hilferuf der zunehmend isolierten Menschen in Barentsburg bewegte nun die russische Regierung dazu, ein Versorgungsschiff zu diesem Aussenposten zu schicken. Wie es nun mit den Beziehungen zwischen Norwegen und Russland in der Hocharktis weitergeht, ist laut Ronny Brunvoll, Leiter der lokalen Tourismusbehörde Visit Svalbard, völlig unklar: «Unser besonderer internationaler Status als neutrales und demilitarisiertes Territorium nützt uns im Moment wenig.» Tatsächlich ziehen jetzt noch mehr dunkle Wolken über dem Archipel unter dem Nordpol auf. So wird in der russischen Duma gegenwärtig ein Vorstoss diskutiert, der auf eine Kündigung des sogenannten «Grenzlinienabkommen» abzielt. Dieses wurde im Jahre 2010 nach über 40 Jahre dauernden Verhandlungen zwischen Moskau und Oslo geschlossen und regelt die Wirtschaftszonen zwischen den Nachbarstaaten zwischen Nordkapp und Nordpol. Für Europa und die Arktis sind dies alles schlechte Nachrichten: Russlands Krieg in der Ukraine zieht immer weitere Kreise. SRF.ch
Österreich – 7’000 offene Stellen in Salzburger Gastronomie.
●20 Jahre Euro: Ausstellung in Nationalbank.
●Die Schriftstellerin Lotte Ingrisch ist tot. Die Witwe Gottfried von Einems ist am Sonntagabend in der Klinik Donaustadt wenige Tage nach einem Sturz gestorben. Ingrisch schrieb unter anderem Theaterstücke und Romane und war für ihren Hang zum Übersinnlichen bekannt. Sie starb 4 Tage nach ihrem 92. Geburtstag. ORF.at
Schweiz – Die WHO hatte bereits im Juni wegen der Häufung der Affenpocken-Fälle in Ländern, in denen die Infektionskrankheit bislang praktisch unbekannt war, einen Notfall-Ausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus 16 Fachleuten zusammen, die sich mit der Krankheit auskennen. In den USA sind inzwischen mehr als 2800 Affenpocken-Fälle bestätigt. Diese Woche sind laut Gesundheitsbehörde CDC auch zwei Fälle von Affenpocken bei Kindern nachgewiesen worden. In der Schweiz müssen Ansteckungen mit Affenpocken seit dem 20. Juli dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldet werden. Wie das BAG schreibt, sollen so Erkenntnisse über den Übertragungsweg von Affenpocken gewonnen werden. In der Schweiz sind bislang 229 Affenpocken-Fälle nachgewiesen (Stand 22. Juli), der erste Fall trat am 21. Mai auf. Derzeit geht das BAG von einer «mässigen Gefahr» für die Bevölkerung aus, wie das Bundesamt auf seiner Website schreibt. Man werde die weitere Entwicklung genau beobachten und die Risikobeurteilung den neusten Erkenntnissen anpassen. Auch den Ausbruch des Coronavirus Sars-CoV-2 hatte die WHO am 30. Januar 2020 als «Notlage» deklariert. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen sich nun bei Affenpocken auf dieselben Massnahmen wie bei der Corona-Pandemie einstellen müssen. Denn die Krankheiten lassen sich nicht miteinander vergleichen. Während sich das Coronavirus durch Aerosole mit Virenpartikeln verbreitet, die Infizierte beim Atmen, Sprechen oder Husten ausstossen, erfolgen Infektionen mit Affenpocken nach derzeitigem Wissensstand in der Regel durch engen Körperkontakt. «Wir haben einen Ausbruch, der sich durch neue Übertragungswege schnell auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Wir wissen zu wenig darüber, aber er erfüllt die Kriterien für eine internationale Notlage», erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstagnachmittag an einer Pressekonferenz in Genf. Mittlerweile seien über 16’000 Affenpocken-Fälle in 75 Ländern bestätigt, darunter fünf Todesfälle. Das Risiko, sich anzustecken, besteht laut WHO derzeit vor allem in Europa. «Das Virus wird hauptsächlich beim Sex unter Männern verbreitet. Das bedeutet, dass dieser Ausbruch gestoppt werden kann – mit den richtigen Strategien in der richtigen Gruppe», sagte Tedros. Wegen Affenpocken-Nachweisen in mehr als 70 Ländern ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine «Notlage von internationaler Tragweite» aus. In der Schweiz sind bislang 229 Affenpocken-Fälle nachgewiesen (Stand 22. Juli).
●Im Zoo Zürich stirbt ein dritter Elefant. Die fünfjährige Elefantenkuh Ruwani ist im Zoo Zürich an einem Herpes-Virus gestorben.
●Es ist wohl eines der beliebtesten Fotosujets der Touristinnen und Touristen, die nach Luzern reisen: die Kapellbrücke mit dem Wasserturm inmitten der Reuss. Im Jahr 2019 – dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie – zählte die Stadt Luzern über eine Million Logiernächte, dazu kamen die Tagestouristen. Sie alle liefen wohl mindestens einmal über die Kapellbrücke und verwendeten dabei Ausdrücke wie «beautiful» oder «merveilleux». Doch was heute die grosse Touristenattraktion ist, war gestern nicht sehr beliebt. Dies sagt Valentin Groebner. Er ist Historiker mit Spezialgebiet Mittelalter und Tourismus und Professor an der Uni Luzern: «Die frühen Reisenden beschreiben Luzern als eng, traurig und menschenleer. Die Brücken seien imposant, aus der Ferne, aber aus der Nähe düster, eng und stinkend.» Die berühmte Holzbrücke wurde um 1360 gebaut. Sie ist also zirka 660 Jahre alt. Mit einer Länge von 205 Metern ist sie die zweitlängste überdachte Holzbrücke in Europa.
●Der Kanton Zürich rüstet in Sachen Cybersicherheit auf. Mit einem neuen Zentrum für Cybersicherheit will die kantonale Verwaltung für die Zukunft gewappnet sein.
●Das Maler- und Gipsergewerbe zeigt: Auch auf der Baustelle funktioniert Teilzeit. Diese Pensumsreduktion ist erwünscht.
●Unfall am Vierwaldstättersee. Auto stürzt von Axenstrasse 50 Meter in die Tiefe. In Brunnen (SZ) ist ein Auto in den Vierwaldstättersee gestürzt. Die Polizei sucht nach vermissten Personen.
●Es blüht derzeit am Wegrand, auf den Feldern oder im Garten – und ähnelt der Kamille: das Einjährige Berufkraut. Trotz ihrer schönen weissen Blüte ist die Blume aber nicht willkommen. Denn sie gilt als ein invasiver Neophyt – also eine nicht-einheimische Pflanze, die sich auf Kosten einheimischer Arten schnell ausbreitet. SRF.ch
Tschechien – Nora Fridrichovas Stimme kennen in Tschechien fast alle. Sie moderiert im Fernsehen jede Woche die Nachrichtensendung «168 Stunden». Und jetzt nimmt sie uns mit ihrer Handykamera mit in ihre «Garderobe» in Prag. «Satnik» heisst die Halle in Prags altem Markt, wo gerade ein Mann volle Plastiktüten ablädt. Täglich geben Menschen hier Kleider, Kosmetik, Essen ab. Täglich bieten hier Tschechinnen und Tschechen Nachhilfe an für Kinder oder Massagen für Mütter und Väter. Fridrichova hat das Hilfswerk vor einem Jahr gegründet. In Tschechien gebe es viele wohlhabende Menschen, die Kleider spendeten. «Auf der anderen Seite gibt es aber Mütter, die sich keine Schuhe leisten können für ihre Kinder.» Das Hilfswerk «Satnik» ist da für Alleinerziehende. Es ist jetzt besonders gefragt, da in Tschechien schnell alles teurer wird. Fridrichovas Kamera fängt eine junge Frau ein, die einem kleinen Mädchen hinterherrennt. Es ist Marie Stulpova, sie zieht ihre beiden Töchter allein gross. Sie arbeitet für Satnik, aber ihr Lohn ist jeden Tag weniger wert. Oft sei der tatsächliche Preis an der Kasse höher als der, der auf dem Etikett stehe. Eigentlich unterstützt der tschechische Staat Ärmere grosszügig, aber Stulpovas Kinder sind gerade herausgewachsen aus dem Alter, in dem es Kleinkinder-Zuschüsse gibt. Eigentlich haben die meisten Menschen in Tschechien ihre eigene Wohnung, aber Marie Stulpova kann sich das nicht leisten und wohnt zur Miete. Ihre Vermieterin habe ihr nun mitgeteilt, dass sie ihr die Miete werde erhöhen müssen. Hilfswerksgründerin Fridrichova sagt, in diesen Zeiten der hohen Inflation sparten ärmere Menschen vor allem beim Essen. «Fleisch, Früchte und Gemüse kaufen die armen Familien nicht mehr, das ist alles sehr teuer geworden.» Die Kinder bekämen stattdessen billige, ungesunde Fertig-Nudelsuppen. Etwa 400 Menschen stellen sich bei «Satnik» an. Es sind derzeit jeden Tag einige mehr. Sie holen Kleider, helfen beim Sortieren und nehmen dafür Essen mit nach Hause. Doch, so sagt Fridrichova, langsam werde es schwierig, Spender zu finden. Alle sparten, wo es nur gehe. «So etwas hat es in Tschechien noch nie gegeben. Die Suppenküchen für Arme haben inzwischen kein Essen mehr, weil so viele Leute dort Schlange stehen», so Fridrichova. Der Alleinerziehenden Marie Stulpova macht allerdings das Morgen noch mehr Sorgen als das Heute: «Dieser Winter wird schlimm. Heizen wird so teuer. Und wir müssen ja auch noch wohnen und essen.» SRF.ch
Tunesien – Erfolg für Präsident قيس سعيد Qais Saied (64). Neue tunesische Verfassung gemäss Nachwahlbefragung angenommen. Bei der Abstimmung über eine neue Verfassung in Tunesien lag die Wahlbeteiligung bei knapp 28 Prozent. SRF.ch
Ungarn – Zum Ukraine-Krieg merkte Orbán an: „Uns wollen Länder, die weit weg sind, erzählen, wir würden uns nicht ausreichend für die Ukrainer engagieren. Dabei geben sie bestenfalls Waffen.“ In Anspielung auf bislang 86 gefallene Soldaten und zivile Opfer der ungarischen Minderheit Transkarpatiens sagte Orbán: „Wir Ungarn geben unser Blut, die uns kritisieren, tun dies nicht.“ Deshalb habe Ungarn als Nachbarland das Recht, den Frieden als einzige Lösung zu bezeichnen, um Menschenleben zu bewahren. MR.hu
USA – Werk in Alabama. Kinderarbeit bei Tochterfirma von Hyundai in den USA. Die Kinder, die in dem Metallstanzwerk gearbeitet haben, waren zwölf, knapp 14 und 15 Jahre alt. SRF.ch
●US Politikerin und Trump-Gegnerin Pelosi (82) fordert für Taiwan Raketen, die die Dämme in der VRC zerstören könnten, was rieige Überschwemmungen mit 100‘000-en Toten auslösen könnte. CGTN.cn
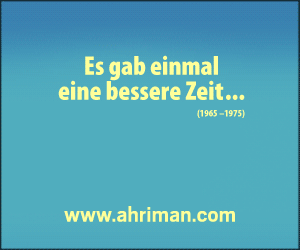
 Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte.
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber “CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE” portofrei und gratis! Details hier.









Sehr interessant der Bericht über Spitzbergen.
Der Eintrag: “Im deutschen Bahn-Nahverkehr kostet ein Ticket derzeit neun Euro – für einen Monat. Das schadet vielen Busunternehmen.” wirft hingegen Fragen auf: Schließlich gilt die Billigstpauschalfahrkarte auch in Bussen, und dürfte über die Fahrgastzahl entsprechend inkl. aller fetten Subventionen (da sitzen die Milliarden locker) auch auf die Busunternehmen die ÖPNV-Vertragspartner sind verteilt werden. Diese leiden jedoch immer noch unter dem immens gesunkenen Fahrgastaufkommen der letzten beiden Jahre.
Reisebusunternehmen die nicht den ÖPNV beschicken sind da schlechter dran: Erst fielen dank der Coronoia viele Reisen aus, und nun fehlt vielen der potentiellen meist ohnehin eher finanziell knappen Busreisegästen das Geld fürs Reisen. Zumal viele Fahrgäste den miefigen Bus nun durch andere Verkehrsmittel oder Camping mit PKW & Caravan ersetzt haben.