Im Internetradio mitgehört und mitgeschrieben von Wilhelm Tell
100 Jahre Radio – Die allererste «Radiosendung» reklamierte die Flugfunkstation Lausanne für sich. Der Techniker und Funker Roland Pièce übertrug im Herbst 1922 Musik ab einem Wachswalzen-Phonographen via Sprechfunkmikrofon zu Flugzeugbesatzung und Passagieren der Fluglinie Lausanne-Paris. Auf diesem Weg übertrug man normalerweise nur Wetterdaten und Wetterprognosen. Wahrscheinlich am 26. Oktober 1922 – das genaue Datum gilt historisch als nicht gesichert, lediglich der Monat Oktober – wurde der Sender «Champ-de-l’Air» offiziell eingeweiht, mit einer erste Übertragung ins Hotel Beau Rivage in Lausanne-Ouchy. Riesige Antennen und miserabler Empfang. Es war eine Sensation, dass das neue Medium Rundfunk die weite Welt in die gute Stube brachte. Man musste allerdings in den Anfängen unpraktische Kopfhörer tragen und die Zuhörenden waren damit an den Apparat gefesselt. Der Bund war ab Beginn der Entwicklung die Konzessions- und Aufsichtsbehörde und hatte damit die Macht über das neue Medium. 1923 bewilligte er erste reguläre Radiosendungen mit den Flugfunksendern. In den 1920er-Jahren finanzierten sich die Radioveranstalter durch Empfangsgebühren der Konzessionäre und durch Beiträge von privater und öffentlicher Seite. Werbung war untersagt. Die privaten Radioveranstalter gerieten so an den Rand des Bankrotts. Deshalb beschloss der Bundesrat, die Ressourcen zu konzentrieren und gründete 1931 die Schweizerische Rundspruchgesellschaft SRG, heute: Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft. Das erste speziell für Radiozwecke errichtete Studiogelände der Schweiz wurde 1933 an der Brunnenhofstrasse in Zürich errichtet und blieb bis Ende August 2022 in Betrieb. In den Anfängen wurde nur am Nachmittag und am Abend gesendet. Die Nachrichten, der Wetterbericht und das regelmässig gesendete Zeitzeichen strukturierten das Programm. Klassische und volkstümliche Musik wurde ab Konserve oder live gespielt. Lesungen, Vorträge, Hörspiele, Gespräche und Predigten ergänzten das Programm. Selten wurde beispielsweise auch bei Fussballspielen der Kommentar live via Telefon ins Studio übermittelt. Explizit politische Sendungen waren aber verboten, Sendungen mit belehrendem Inhalt hingegen Verpflichtung; auch noch lange nach der Gründung der SRG. Auf Druck der Zeitungsverleger durften die Radios nicht einmal die Nachrichten produzieren. Diese wurden von der Nachrichtenagentur SDA zusammengestellt und verlesen. Mit den ersten brauchbaren Tonaufzeichnungsgeräten ab Mitte der 1930er-Jahre konnten Sendungen vorproduziert und zeitverschoben ausgestrahlt werden. Dies ermöglichte, dass Sendungen auch mehrfach ausgestrahlt werden konnten. Die Radioreporter verliessen nun immer mehr das Studio und es kam die Zeit der grossen Reportagen mit Reportagewagen über grosse Sportereignisse, Feste, Bräuche oder etwa Firmen. Nach Kriegsende wurde Unterhaltung wieder grossgeschrieben. Hörspiele, wie zum Beispiel «Polizischt Wäckerli», waren Strassenfeger und boten Gesprächsstoff am Stammtisch und zu Hause. Das Radio setzte zum Höhenflug an. 1949 konnte der millionste Radiokonzessionär begrüsst werden. Das Programm wurde laufend ausgebaut. Ab 1945 leistete sich das Radio eigene Korrespondenten. Für Radio Beromünster waren dies Hans O. Staub in Paris, Theodor Haller in London und Heiner Gautschy in New York. In der Zeit des Kalten Krieges durfte nicht alles gesendet werden. Sendeverbot erhielt zum Beispiel der Kabarettist Alfred Rasser wegen einer Chinareise. Und wer einmal nach Russland gereist war, wurde im Radio nicht mehr beschäftigt. Immer noch war das Programm edukativ, die Kultur musste ‹eine gewisse Höhe› haben. Der Sprechstil war immer noch eher gestelzt. Deshalb wanderte auch ein Teil der Jugend zu ausländischen Sendern ab. Das Fernsehen in der Schweiz nahm 1958 seinen definitiven Sendebetrieb auf. Bereits in den 60er-Jahren gab es einen rasanten Zuwachs an Fernsehzuschauenden. Damit verlor das Radio einen Teil seiner bisherigen Bedeutung. In den 60er-Jahren machten erste Radiopiraten von sich reden. In den 70er-Jahren herrschte ein regelrechter Boom. Es gab Sender mit kommerziellen und deren mit politischen Absichten: Radio Schwarze Katze, Sender radioaktiv-freies Gösgen, feministische Wällehäx, Radio AJZ, Radio Kangohammer, und viele mehr. Eine erste richtige Konkurrenz erwuchs der SRG durch Roger Schawinski mit Radio 24. 1983 vergab der Bundesrat 36 Konzessionen an private Lokalsender. Die SRG antwortete auf diese Herausforderung im selben Jahr mit der Gründung der Jugendsender Couleur 3 und DRS 3, heute SRF 3. Heute sind die privaten Radios durch die Ausstrahlung auf DAB+ zu nationalen Radios geworden, vom Gebührentopf. SRF.ch
China – Als Staatschef Xi Jinping vor knapp zehn Jahren erstmals seinen Plan für die «Seidenstrasse des 21. Jahrhunderts» ankündigte, war das Konzept schwer zu fassen. Stand heute hat China entlang der Land- und Seehandelsrouten systematisch Beteiligungen an strategisch wichtigen Infrastrukturen erworben. Die Rede ist von rund einer Billion US-Dollar. Laut Xi erreichen Güterzüge aus China heute 200 Städte in 24 europäischen Ländern. Weltweit sei in rund 100 Häfen in über 60 Ländern investiert worden. So auch beispielsweise in Sri Lanka, wo sich China im Hafen Hambantota für 99 Jahre die Führung gesichert hatte. Experten gehen davon aus, dass China zum weltweit wichtigsten öffentlichen Geldgeber für Entwicklungs- und Schwellenländer geworden sei. Der Ökonom Sebastian Horn schätzte im Interview mit der NZZ, dass China mehr Kredite vergibt als die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds. China betreibe «Schuldendiplomatie». Martin Aldrovandi erklärt: «Viele Staaten haben sich für die Projekte hoch verschuldet, und es ist fraglich, ob sie das Geld je zurückzahlen können.» Auch darum habe die Skepsis gegenüber der neuen Seidenstrasse in den vergangenen Jahren zugenommen. Denn letztendlich steigen mit den Schulden auch die chinesischen Einflussgebiete. So beobachtet SRF-Australien-Korrespondent Urs Wälterlin bei verschiedenen Pazifik-Inselstaaten: «Wer Geld will, muss Peking unterstützen und sich beispielsweise diplomatisch von Taiwan abwenden.» Doch schieben die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und eine abkühlende Weltwirtschaft dem chinesischen Prestige-Projekt nicht einen Riegel vor? Das Gegenteil könnte der Fall sein.
Denn China kann mit seinen finanziellen Mitteln dort in die Bresche springen, wo gewisse Staaten selbst nicht mehr aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten herauskommen. So sprach Xi Jinping am diesjährigen kommunistischen Parteitag von «Chinas Beitrag zu einer Weltwirtschaft, die allen Völkern grösseren Nutzen bringt.» Chinas Staatschef betonte gleichermassen, wie die neue Seidenstrasse den Wohlstand inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie fördern würde. SRF.ch
● China eröffnet eigene Polizeibüros in den meisten europäischen Ländern, um chinesische Kriminelle besser anpacken zu können. NPO.nl
Deutschland – Der Hamburger Hafen sagt, ohne Beteiligung der Chinesen sind wir verloren – die europäischen Häfen funktionieren extrem kompetitiv. Das spielt den Chinesen in die Hände. Volker Treier vom deutschen Industrie- und Handelskammertag hält den chinesischen Investor Cosco für wichtig. Er sei schon in zig anderen europäischen Häfen präsent. Für Hamburg bestehe verglichen zu anderen europäischen Häfen ein Nachteil. «Wir würden ihn durch den Einstieg des chinesischen Investors ausgleichen. Der spielt in der Logistik eine wichtige Rolle und würde uns weiter den Zugang zu den chinesischen Märkten sichern», so Treier. Die deutsche Regierung will ihre künftige Beziehung zu China ändern. Sie will die Menschenrechte ansprechen und einpreisen, will der Systemrivalität Rechnung tragen. So hält sie es im Koalitionsvertrag fest. Namhafte Chinaexperten befürworten mehr Härte im Umgang mit Peking. SRF.ch Die Bundesregierung hat genehmigt, dass der chinesische Staatskonzerns Cosco beim Hamburger Hafen einsteigen darf. RBB.de
Indien – feiert zum Fest des Lichts den neuen britischen Premier Rishi Sunak (42), der indischer Abstammung ist. SRF.ch
Italien – Giorgia Meloni, die neue Premierministerin Italiens, hat im Parlament ihre erste Regierungserklärung abgegeben. Die Ansprache dauerte über eine Stunde. Giorgia Meloni war sich klar, dass ihr heutiger Auftritt im In- und Ausland mit Argusaugen beobachtet würde. «Ich bin das, was die Briten einen Underdog nennen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und musste mich gegen alle Widrigkeiten nach oben durchbeissen. Das habe ich geschafft und habe es auch weiterhin vor», so Meloni. Meloni blieb auch ihrer Linie aus dem Wahlkampf treu. Sie gab sich als konservativ, wirtschaftsliberal, aber einigermassen moderat. Italien stehe ohne Wenn und Aber zur Nato und zum Westen im Ukrainekrieg. Italien werde innerhalb der EU Politik machen. Nicht gegen die EU. Aber Italien werde ohne Unterwürfigkeit gegenüber anderen EU-Mitgliedern auftreten. Gemeint waren Paris und Berlin. Dass Italien von den anderen Europäern über den Tisch gezogen werde, ist ein typisches Narrativ der Fratelli d’Italia. Es war schon anfangs des 20. Jahrhunderts ein gängiges Argument der Rechten bis Rechtsextremen. Meloni grenzte sich zwar klar vom italienischen Faschismus ab, bettete aber diese Abgrenzung in eine Ablehnung gegen jeglichen Totalitarismus ein. Und sie sagte damit quasi: Wir waren nicht die einzigen. Immerhin ergänzte sie, die Verbrechen liessen sich nicht gegeneinander aufrechnen. Giorgia Meloni ist die schwierige Lage Italiens bewusst: Eine Staatsverschuldung von 145 Prozent des BIP, die nur von Griechenland übertroffen wird, eine Inflation von über 11 Prozent, Wachstumsprognosen von unter einem Prozent bis zur Vorhersage einer Rezession. Meloni kündigte eine liberale Wirtschaftspolitik an, mit Steuersenkungen und Abbau der Bürokratie. Interessant war: Sie hielt an ihrem Ziel fest, in Italien ein Präsidialsystem wie in Frankreich einzuführen, was einer Regierung einerseits mehr Stabilität, aber auch eine viel mehr Machtfülle gibt. Und sie kündigte an, dass Italien im Falle einer neuen Covid-Welle viel weniger restriktiv als in der Vergangenheit vorgehen werde. Italien habe das strengste Covid-Regime in Europa gehabt, aber trotzdem zu den Staaten mit der höchsten Sterblichkeit und Sterberate gehört. Meloni widmete einen separaten Punkt in ihrer Rede der Förderung der Jugend und der Überalterung der Gesellschaft. Denn Italien habe die tiefste Geburtenrate seit 1861. Und sie kündigte an, sich für Hotspots für Flüchtlinge in Afrika einsetzen zu wollen, wo ihre Asylanträge nach Europa geprüft würden. Eine Kontrolle vor der nordafrikanische Küste solle Flüchtlingsboote frühzeitig abfangen. Im vielem war Melonis Regierungserklärung eine politische Standardrede. Kampf gegen die Mafia, Förderung des Südens, aufrecht gegen Brüssel. Und sie glich in vielen Punkten jenen ihres jetzigen Bündnispartners Silvio Berlusconi vor zehn Jahren. Was solche Ankündigungen wert sind und wie diese Regierung wirklich tickt, wird sich erst in der Praxis weisen. Beispielsweise, wenn es um Minderheitenrechte oder Abtreibung geht. So viel Geduld muss, so viel Skepsis darf man haben. SRF.ch
Japan – Ein Wissenschaftsteam erzeugt die derzeit kälteste Materie im ganzen Universum. Und zwar kühlt das Team sogenannte Fermionen wie Protonen, Neutronen und Elektronen von Yttrium-Atomen auf ein milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt herunter. Der Nullpunkt ist jene Temperatur, bei welcher jegliche Bewegung aufhört. Dieser liegt bei minus 273,15 Grad. Kein Ort oder Gegenstand im Universum kann kälter werden. Seit Jahrzehnten versuchen Forschende, diesem Punkt so nahe wie möglich zu kommen. Der derzeit kälteste bekannte Ort im Universum ist der Bumerang-Nebel mit einem Grad über dem Nullpunkt. In dieser Kälte bekommt Materie ganz neue Eigenschaften und die Gesetzte der klassischen Physik gelten nicht mehr. Stattdessen wird deutlich, wie sie sich auf Quantenebene verhalten. Die Physiker können die Atome in einem 3-D-Gitter fangen und direkt in Aktion beobachten, wie diese komplexen Quantensysteme funktionieren. SRF.ch
Österreich – Dietrich Markwart Eberhart „Didi“ Mateschitz verstarb am 22.10. (* 20. Mai 1944 in Sankt Marein im Mürztal, Steiermark). Er machte die Marke Red Bull international bekannt und galt als reichster Österreicher. Ausserdem gründete er das Red Bull Media House, das den Fernsehsender ServusTV betreibt. Mateschitz’ Mutter Auguste aus der Steiermark und sein aus Maribor stammender Vater liessen sich früh scheiden. Er hatte eine vier Jahre ältere Schwester, Helgard. Nachdem er die Hochschule für Welthandel in Wien als Diplomkaufmann absolviert hatte, war er unter anderem als Handelsvertreter für Jacobs Kaffee und den Zahnpastahersteller Blendax im Marketing tätig. Während einer Geschäftsreise nach Thailand wurde Mateschitz 1982 auf den von Chaleo Yoovidhyas Firma T. C. Pharmaceuticals produzierten Energydrink Krating Daeng („roter Stier“) aufmerksam. ORF.at
Russland – hat einen Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrates veröffentlicht, der die Einrichtung einer Kommission vorsieht, die die Aktivitäten von US-Biolabors in der Ukraine untersucht. Der Entwurf soll während der Sitzung des Sicherheitsrates am 27. Oktober geprüft werden. Darin heisst es, dass der UN-Sicherheitsrat „eine aus allen Mitgliedern des Sicherheitsrats bestehende Kommission einsetzen sollte, um die in der Beschwerde der Russischen Föderation enthaltenen Behauptungen gegen die USA und die Ukraine bezüglich der Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Biowaffen- Übereinkommen im Zusammenhang mit den Aktivitäten biologischer Laboratorien im Hoheitsgebiet der Ukraine sowie Vorlage eines Berichts zu diesem Thema mit Empfehlungen bis zum 30. November 2022 an den Rat und Unterrichtung der Vertragsstaaten des Übereinkommens auf seiner neunten Überprüfungskonferenz Genf vom 28. November – 16. Dezember 2022 über die Ergebnisse der Untersuchung.”.VESTI.ru ● Die US-Basketballerin Brittney Griner muss in Russland für neun Jahre hinter Gitter. Ein Gericht in Moskau hat eine Einsprache der Olympionikin gegen ihre Verurteilung abgewiesen. Griner sitzt seit Mitte Februar wegen Drogenschmuggels in Russland im Untersuchungshaft. Die zweifache Olympiasiegerin ist seit Februar inhaftiert. Sie war am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck mitführte. Griner hatte in einer Videoschalte beteuert, die Haft sei «sehr, sehr stressig und traumatisch» und bat das Gericht darum, die Strafe zu reduzieren. Das Gericht lehnte dies ab, erklärte aber, dass jeder Tag ihrer Haft als eineinhalb Tage auf ihre Strafe angerechnet würde. Demnach muss Griner noch rund acht Jahre in Haft bleiben. Das Urteil war Anfang August gefällt worden. Marihuana ist in Russland verboten, Griner sagte aus, sie habe aufgrund ihrer zahlreichen Verletzungen die Erlaubnis eines US-Arztes, medizinisches Cannabis zu nutzen. SRF.ch
Schweiz – 43 % weniger Reingewinn. Novartis mit deutlichen Gewinnrückgang im 3. Quartal. Der Reingewinn beträgt neu 1.58 Milliarden US-Dollar, wie der Pharmakonzern mitteilt.
● UBS übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang. Die Schweizer Bank UBS hat im dritten Quartal 2022 einen Gewinn von 1.73 Milliarden Dollar geschrieben.
● Kommt es in der Schweiz vermehrt zu Streiks? Die Gewerkschaften wären dazu in der Lage, so Historiker Christian Koller. Und dann könne auch glaubhaft gedroht werden.
● Wölfe reissen viele Nutztiere. Glarner Bauern: «2022 darf sich nicht wiederholen». Der Wolf lässt in Bergkantonen die Emotionen hochgehen – auch in Glarus, wo in diesem Jahr 90 Tiere gerissen wurden.
● Swiss und Piloten mit Einigung.
● Am Dienstag, 25. Oktober findet um die Mittagszeit eine partielle Sonnenfinsternis statt.
● Saftige Preiserhöhungen: Heizen Grosskonzerne die Inflation an? Die Energiekosten befeuern die Inflation weltweit. Diskutiert wird aber auch, ob Grosskonzerne die Teuerung antreiben.
● Im Schweizer Asylsystem fehlt das Personal. In den Bundesasylzentren herrscht ein Fachkräftemangel. Eine Herausforderung bei steigender Zahl an Asylsuchenden.
● Mit der Klimaerwärmung steigt das Risiko für Waldbrände. Die Feuerwehren in der Schweiz rüsten auf.
● Sozialhilfebezüger sollen eher in Arbeitsmarkt integriert werden. Als vorbildlich gilt dabei das Basler Projekt «Enter», bei dem die Menschen besonders eng begleitet werden.
● Bundesasylzentren sind am Anschlag. Um allen Asylsuchenden eine Unterkunft zu garantieren, wird ein Teil früher als bisher den Kantonen zugewiesen. SRF.ch
Slowakei In der Slowakei sind heute 1500 ausländische Nato-Soldaten stationiert. Politisch sei das ein Riesenschritt, sagt in Bratislava Vize-Verteidigungsminister Marian Majer. Jets der Nato-Länder überwachen den slowakischen Luftraum. Noch vor kurzem war das unvorstellbar. In kaum einem anderen osteuropäischen Nato-Mitgliedsstaat ist die Skepsis gegenüber der Nato so gross. Vor dem Krieg in der Ukraine wäre das kaum vorstellbar gewesen. Zu gross war die Ablehnung gegen ausländische Soldaten auf slowakischem Boden. Noch Anfang dieses Jahres drohte ein neues Militärabkommen mit den USA am politischen Widerstand zu scheitern. Fast die Hälfte des Parlaments wollte keine zusätzlichen amerikanischen Soldaten in der Slowakei. Und in Umfragen befürworteten noch unmittelbar vor dem Ukraine-Krieg weniger als die Hälfte der Bevölkerung die Nato-Mitgliedschaft der Slowakei. Heute ist es eine Mehrheit. Und doch ist die Kritik an den ausländischen Truppen in der Slowakei nach wie vor lauter als in anderen osteuropäischen Nato-Staaten. Wichtige Oppositionspolitiker behaupten, die Nato sei mitverantwortlich für den russischen Überfall auf die Ukraine. SRF.ch
Sudan – Die Menschen in Sudan sind müde ob der vielen Toten. Die Auseinandersetzungen zwischen Militär-Junta und Demonstranten dauern an. SRF.ch
Ukraine – Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Kiew zu seinem ersten Besuch seit Beginn des Krieges. Er will sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski treffen.
● Russland ist weiterhin überzeugt, dass Kiew mit einer nuklear verseuchten Bombe Moskau diskreditieren will. Aussenminister Sergej Lawrow will den Fall vor die UNO bringen. SRF.ch
USA – US-Schulen rüsten auf. Immer mehr Lehrer nehmen ihre Schusswaffen in die Schule mit.
● In den Zwischenwahlen (Midterms) am 8. November geht es einerseits um die Mehrheit im Kongress, dem US-Parlament in Washington. In der grossen Kammer, dem Repräsentantenhaus, werden alle Abgeordneten neu gewählt. In der kleinen Kammer werden ein Drittel der Sitze neu gewählt. Derzeit haben die Demokraten eine knappe Mehrheit in beiden Kammern. Historisch gesehen verliert die regierende Partei jedoch meist Sitze in den Zwischenwahlen. Zusätzlich geht es am Termin der Zwischenwahlen aber auch um viele einflussreiche Gouverneursposten sowie Parlamentssitze auf Ebene der Bundesstaaten.
● Forscher in den USA haben menschliche Hirnzellen in die Hirne von jungen Ratten eingepflanzt, überschreiten damit ethische Grenzen und hoffen auf Erkenntnisse zu Schizophrenie und Autismus. SRF.ch







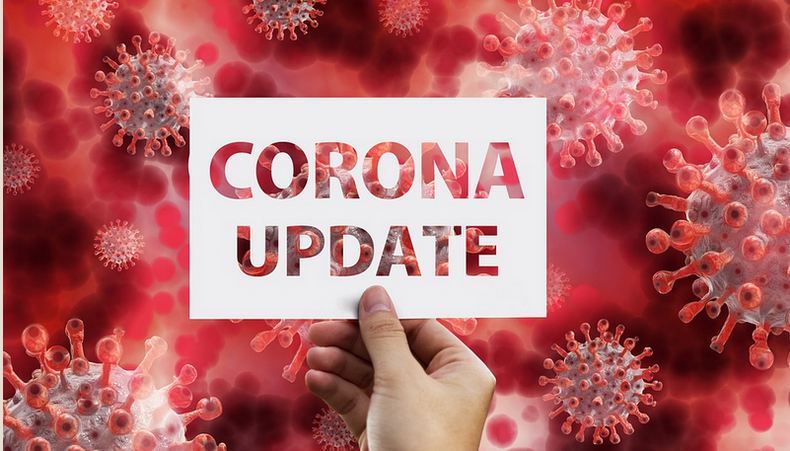
Ihr Beitrag wartet auf die Moderation
Was in der himmlischen Welt berichtet wurde.
http://christi.ist
Der Name des Teufels, des bösen Geistes lautet: „El-Schaddai“
Siehe: http://www.bibleserver.com/LUT.SLT/1.Mose17
Gelobt sei der da war und der da ist,
~ ewiglich ~
Und da her weht der böse Wind: https://www.bitchute.com/video/F6wT1iGouBDq/
Gelobt sei Jesus Christus, der Christos,
~ ewiglich ~
Ihr Beitrag wartet auf die Moderation
Was in der himmlischen Welt berichtet wurde.
christi.ist
Der Name des Teufels, des bösen Geistes lautet: „El-Schaddai“
Siehe: http://www.bibleserver.com/LUT.SLT/1.Mose17
Gelobt sei der da war und der da ist,
~ ewiglich ~
Was in der himmlische Welt berichtet wurde.
http://christi.ist
Der Name des Teufels, des bösen Geistes lautet: “El-Schaddai”
Siehe: https://www.bibleserver.com/LUT.SLT/1.Mose17
Gelobt sei der da war und der da ist,
~ ewiglich ~