Im Internetradio mitgehört und mitgeschrieben von Wilhelm Tell
Arktis – Jahrzehntelang war die Nordpolarregion eine der friedlichsten weltweit. Nirgendwo kooperierten Russland und der Westen so eng und vertrauensvoll wie hier. Doch nun wird die Arktis zum Kollateralschaden des Ukraine-Kriegs. Die Zusammenarbeit wird eingestellt, im hohen Norden droht gar ein Wettrüsten. Eine neue Ernsthaftigkeit prägte dieses Jahr die Arktis-Manöver «Cold Response» der Nato, ganz im Norden von Norwegen. Mit mehr als 30000 Soldaten aus 27 Ländern waren sie die bisher grössten nördlich des Polarkreises. Die militärischen Aktivitäten im Polarraum nehmen stark zu, vor allem von russischer Seite. Doch nun erhöhen auch die westlichen Alliierten ihre Präsenz. Die Hälfte der Küstenlinie in der Arktis gehört Russland, die andere Hälfte teilen sich Kanada, die USA, das zu Dänemark gehörende Grönland, Island und Norwegen, allesamt Nato-Mitglieder. Die beiden Machtblöcke prallen also im Eismeer direkt aufeinander. Von den meisten Nato-Soldatinnen und -Soldaten ist zu hören: Sie fühlen sich wieder wichtig, seit das Szenario eines Krieges auch in Westeuropa wieder ernsthaft diskutiert wird. Norwegens Armeechef Eirik Kristoffersen nennt das «ein neues Gefühl für die eigene Bedeutung, eine neue Dringlichkeit».Dreissig Jahre lang haben die Anrainerstaaten rund ums Nordpolarmeer gut zusammengearbeitet. In der wichtigsten Institution, dem Arktis-Rat, wurde stets darauf Wert gelegt, Machtpolitik möglichst auszublenden. Doch ob der Geist der Kooperation auch den aktuellen Ukraine-Krieg überlebt, ist zweifelhaft. Die Aktivitäten des Rates sind seit Kriegsbeginn ausgesetzt. Der Klimawandel war der Treiber der Interessenkonflikte in der Arktis, der Ukraine-Krieg ist nun der Brandbeschleuniger. Vorbei die Zeiten, als die Nordpolarregion sehr weit weg war – einsam, arm, kalt, ruhig und friedlich. Mit der Ruhe in der Arktis ist es vorbei. Ob auch mit dem Frieden, dürfte sich bald weisen. SRF.ch
Bosnien und Herzegowina – Das Land ist auch fast 30 Jahre nach dem Krieg noch immer tief gespalten. Die Wunden von damals wollen nicht wirklich verheilen. Und gerade die politische Elite nutzt das gerne aus. «Der Staat ist dysfunktional und bedient nur noch die Interessen einer kleinen Elite. Und diese politische Klasse ist nicht bereit, zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu schliessen», sagt die Historikerin Marie-Janine Calic. Ein Krieg stehe Bosnien und Herzegowina derzeit aber nicht unmittelbar bevor, meint Calic: «In Bosnien-Herzegowina herrscht eine extrem angespannte Situation. Ein grosser Krieg ist dennoch nicht wahrscheinlich. Vor allem deshalb, weil die Konfliktparteien gar nicht über die militärischen Mittel verfügen. Zudem befindet sich eine internationale Schutztruppe in Bosnien, die Eufor Althea, die wird einen solchen Krieg verhindern. Auch politische Interessen sprechen gegen einen Krieg. Weder die Nachbarn Kroatien und Serbien noch die Parteien in Bosnien haben wirkliche Interessen an einem grossen Krieg.» SRF.ch
Deutschland – EZB hebt Leitzins um 0.75 Prozentpunkte an. Um ihre Glaubwürdigkeit zu retten, konnte die EZB kaum anders. Sie musste die Zinsen kräftig erhöhen. Denn die Preise für die Dinge des täglichen Bedarfs schiessen in Europa gefährlich in die Höhe. Konkret: Die Teuerungsrate in der Eurozone beträgt aktuell gut 9 Prozent – Tendenz steigend. Das Inflationsziel der EZB jedoch ist 2 Prozent. Anspruch und Wirklich klaffen krass auseinander. Inflation ist ein anderes Wort für Geldentwertung. Das heisst: Je schneller die Euros der Konsumenten an Wert verlieren, desto schlimmer. Die Inflation plagt auch die Firmen. Sie treibt deren Kosten nach oben und drückt auf die Gewinne. Das Schwierige an der Lage ist: Die anhaltend hohen Energiepreise drohen unterdessen, die ganze Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Und gegen diesen – geopolitisch bedingten – Preisschock ist die EZB machtlos. Denn steigende Zinsen machen Öl, Gas und Strom auf dem Weltmarkt nicht günstiger. Das räumte EZB-Chefin Christine Lagarde heute vor den Medien ein. Schlimmer noch: Steigende Zinsen verteuern die Kredite für den Konsum und die Investitionen. Das ist exakt die Mechanik, mit der die Geldpolitik aller Notenbanken funktioniert. Steigende Zinsen dämpfen somit die Konjunktur. Die Unternehmen investieren weniger, stellen weniger Personal ein. Die Beschäftigung geht zurück; die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Konsumentenstimmung trübt sich weiter ein, die Nachfrage schrumpft. Ganz allmählich nimmt der Teuerungsdruck dadurch ab. Doch das braucht Zeit. Mit anderen Worten: Die jüngsten Zinserhöhungen der EZB sind eine bittere Medizin mit schmerzlichen Nebenwirkungen für die gesamte Wirtschaft. Zunächst werden die Menschen vom gewünschten Effekt zudem wenig spüren. Sogar die EZB prognostiziert, dass die Inflation kommendes Jahr noch im Schnitt über 5 Prozent betragen dürfte. Erst für das übernächste Jahr, also 2024, hofft sie auf lediglich gut 2 Prozent Inflation. Womit dann das Ziel erreicht wäre. In der Schweiz richtet sich als Nächstes der Blick auf die Nationalbank: Wird sie mit einer kräftigen Zinserhöhung nachziehen? In zwei Wochen ist wieder ein Zinsentscheid der SNB fällig. Dass sie mit den Zinsen rauf geht, gilt als ausgemacht. Doch steht sie nicht derart stark unter Druck wie die EZB, denn in der Schweiz ist die Inflation mit 3.5 Prozent nicht einmal halb so hoch wie in der Eurozone. Aber auch die Nationalbank muss aufpassen, dass sie nicht ihre Glaubwürdigkeit riskiert. Entsprechend entschieden wird sie gegen die Teuerung einschreiten – so gut es eben geht. SRF.ch
El Salvador – Vor einem Jahr hat das zentralamerikanische Land als erstes Land der Welt Bitcoin als offizielle Währung eingeführt. Gleichzeitig lancierte die Regierung eine App, mit der man kostenlos Bitcoin gegen Dollar eintauschen kann. Wer die App auf sein Smartphone geladen hat, erhielt ein Startguthaben von 30 Dollar. Der Kurs des Bitcoins ist zur Wochenmitte gesunken und nun unter die Marke von 19’000 Dollar abgerutscht. Die Kryptowährung leidet laut Marktbeobachtern weiterhin unter Zins- und Rezessionsängsten und der damit einhergehenden Risiko-Aversion. SRF.ch
Frankreich – Nach Erdbeben mit Stärke 4.7 in Mulhouse zittert die Erde erneut. Weiteres spürbares Nachbeben der Stärke 3.1 in französisch-Schweizer Grenzregion. SRF.ch
Grossbritannien – Erinnerungen an die Monarchin. Die erste Begegnung mit der Queen erlebte die Schweizerin Zita Langenstein an deren 80. Geburtstag. Mit ihrer Diplomarbeit an der Butlerschule in London gewann sie den ersten Preis und durfte diesen der Queen präsentieren. Danach arbeitete sie immer wieder an Grossanlässen bei der Queen – unter anderem bei der Hochzeit von Prinz William. Im Durchschnitt war Langenstein 10 Mal pro Jahr im Dienste Ihrer Majestät. “Ich habe ihre Stimme, ihre spezielle Art und ihren unglaublichen Humor geliebt. Egal ob nur eine Person oder Tausende da waren, sie gab jedem und jeder das Gefühl, dass er oder sie speziell war. Und sie war immer wahnsinnig gut vorbereitet: Ich erinnere mich an die erste Begegnung, wie sie berichtet hat, was sie alles von der Schweiz weiss – und noch Fragen gestellt hat, wo eher ich dann in die Bredouille gekommen bin, aber sicher nicht sie.”
● Starkoch Anton Mosimann (75). 40 Jahre die Queen bekocht: «Sie war eine Perfektionistin». Kaum ein Schweizer ist der Queen so oft begegnet wie Starkoch Anton Mosimann. Der Solothurner kochte über Jahrzehnte Dutzende Male für die Königin und ihre Gäste. Es folgten viele grosse Bankette: Für Anton Mosimann das prestigeträchtigste war 2012 – das Staatsbankett zum 60. Thronjubiläum von Queen Elizabeth der Zweiten. Es sei es ein spezieller Moment gewesen. Für so viele VIP’s gleichzeitig ein Essen zuzubereiten – das habe er zuvor noch nie. «Es waren 150 Leute, im Buckingham Palast – mit über 40 Königinnen und Königen. Eine unglaubliche Erfahrung», beschreibt Mosimann.
● Charles III. ist jetzt auch von Amtes wegen König. Zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr ältester Sohn Charles nun auch offiziell und feierlich als König ausgerufen worden. Im Anschluss beteuerte Charles III. am Samstag, dem Vorbild seiner Mutter folgen zu wollen. «Ich bin mir des grossen Erbes und der Pflichten und schweren Verantwortung des Monarchen, die mir nun übertragen wurden, zutiefst bewusst», sagte der neue britische Monarch. Die Regentschaft seiner am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorbenen Mutter sei unübertroffen gewesen in Länge, Hingabe und Ergebenheit. Um die Proklamation hör- und sichtbar für das Volk zu machen, wurde Charles III. auch auf dem Balkon des St.-James’s-Palastes zum König ausgerufen – mit Fanfarenstössen und im Beisein zahlreicher Soldaten mit Bärenfellmützen. Vorher war das schon im Inneren des Gebäudes in der Londoner Innenstadt – nicht weit vom Buckingham-Palast entfernt – geschehen. Bei der Proklamation handelte es sich um einen formalen Akt – der 73 Jahre alte Charles war bereits mit dem Tod seiner Mutter automatisch britischer König geworden. Es wurde eigens ein Accession Council einberufen, ein «Thronbesteigungsrat», dem Mitglieder des Kronrates angehören – also aktive und frühere Regierungsmitglieder, Kirchenvertreter, Richter, Mitglieder der königlichen Familie und andere Persönlichkeiten. Als Erster unterzeichnete der älteste Sohn des Königs und neue Thronfolger, Prinz William (40), die Proklamation – gekleidet in einem eleganten Gehrock mit schwarzer Krawatte. Er war erstmals seit dem Tod seiner Grossmutter, Elizabeth II., bei einem formellen Termin in der Öffentlichkeit zu sehen. Danach unterzeichnete Charles’ Ehefrau, Königin Camilla (75). Charles sagte später bei der Zeremonie: «Ich bin in alldem zutiefst bestärkt durch die fortwährende Unterstützung meiner geliebten Frau.» Camilla wurde durch den Tod von Queen Elizabeth II. zur Queen Consort. Den Titel trug zuletzt die Mutter der gestorbenen Monarchin, Queen Mum. William, bislang offiziell Herzog von Cambridge, hat nun den Titel Prinz von Wales, den der Thronfolger üblicherweise trägt. Das hatte Charles bereits in seiner Rede an die britische Nation am Freitag bestätigt. Williams Frau Kate (40) wird Prinzessin von Wales. Diesen Titel hatte zuletzt die 1997 bei einem Autounfall gestorbene Mutter von William, Prinzessin Diana, aktiv getragen. Nach der Proklamation folgt noch eine Krönung – der Termin dafür ist noch offen. Die Krönung von Elizabeth II. fand 1953 statt – 16 Monate, nachdem sie nach dem Tod ihres Vaters Königin geworden war. Die Queen war am Donnerstag auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Der Leichnam soll an diesem Sonntag von dort zuerst in den Holyrood-Palast in Edinburgh, die Residenz der Königin in Schottland, überführt werden. In der schottischen Hauptstadt soll der Leichnam anschliessend in einer Kathedrale aufgebahrt werden, bevor er nach London gebracht wird. Charles genehmigte bei seiner Proklamation einen zusätzlichen Feiertag für die Menschen in Grossbritannien. Das könnte darauf hinweisen, dass das Staatsbegräbnis für die Queen am Montag, dem 19. September, stattfinden soll. Als möglicher Termin gilt bisher auch der 18. September, doch das ist ein Sonntag. Eine offizielle Bestätigung des Datums steht noch aus. SRF.ch
Irak – Susanne Brunner: Was der Irak mit dem Exodus seiner Juden verlor. 2500 Jahre lang lebten Jüdinnen und Juden im Irak. In Bagdad war einst gar ein Viertel der Bevölkerung jüdisch. Dann: Der Holocaust, der Zweite Weltkrieg und die Staatsgründung Israels. Heute gibt es kaum mehr Juden im Irak, und auch immer weniger Christen. Das macht auch vielen Muslimen Angst. Der Schriftsteller Eli Amir, 85, lebt in Jerusalem. Bis heute sehnt er sich nach seiner Geburtsstadt Bagdad, obwohl seine jüdische Familie dort auch schreckliche Erfahrungen gemacht hat. Sie überlebte den «Farhud» von 1941, den zweitägigen Pogrom in Bagdad. Danach begann der grosse – zum Teil auch erzwungene – Exodus der jüdischen Bevölkerung aus dem Irak. In Bagdad erinnern sich viele mit Nostalgie an ihre jüdischen Nachbarn von einst. Musliminnen und Muslime schwelgen auf dem ehemaligen jüdischen Hanun-Markt in den Erinnerungen an alte Zeiten, erzählen, wie Religion im Alltag kaum eine Rolle gespielt habe, und wie eng die nachbarlichen Beziehungen einst waren. Auch sie sehnen sich nach dem Bagdad, an das Eli Amir noch jeden Tag denkt, und an einen Irak, den man einst «Vater der Religionen» nannte, weil so viele religiöse Minderheiten dort lebten. «Der Irak ist wie ein Blumenstrauss: entfernt man eine Blume nach der anderen, dann ist es nicht mehr der Irak», sagt Lara Yussif Zara, die christliche Bürgermeisterin von Alqosh. Sie weiss, wovon sie spricht: Der Irak hat nicht nur seine Juden, sondern auch achtzig Prozent seiner Christinnen und Christen verloren. Der Verlust der religiösen Minderheiten wurde mit dem US-Einmarsch in den Irak 2003 beschleunigt. Auch, weil der schiitische Mullah-Staat Iran das Chaos nach den Kriegen, die auf den Sturz Saddam Husseins folgten, nutzte, um den Irak zu kontrollieren. Den alten Irak, nach dem sich heute viele Menschen sehnen, gibt es noch im Kleinen: zum Beispiel in einer versteckten Synagoge in Bagdad. «International», SRF.ch
Pakistan – Die Schweizer Bevölkerung zeigt sich hinsichtlich der Überschwemmungen in Pakistan hilfsbereit. Innerhalb von zehn Tagen erhielt die Glückskette 2.1 Millionen Franken. UN-Generalsekretär António Guterres ruft die Weltgemeinschaft zu umfassender Hilfe auf. Der ungewöhnlich schwere Monsun-Regen und das Abschmelzen von Gletschern sind Auslöser der Überschwemmungen. Bisher wurden landesweit über 1400 Tote gezählt. Vielerorts sind Häuser, Ackerland mitsamt Vieh, Strassen und Bahngleise fortgespült worden. SRF.ch
Pazifik – In einem Workshop erzählen junge Menschen aus dem Pazifik: Dort steigt der Meeresspiegel, Gemeinschaften müssen deshalb umgesiedelt werden. Der Boden verhärte durch das Meersalz. Landwirtschaft werde immer schwieriger. Dennoch klagen sie nicht als Opfer. Vielmehr präsentieren sie ihre Umwelt-Ethik. Die basiere auf der Weisheit ihrer Vorfahren: «Nimm nur so viel, wie du brauchst. Wenn du etwas nimmst, gib es zurück. Deshalb pflanzen wir Bäume, wenn wir welche fällen», sagt James Bhagwan von der Pazifischen Kirchenkonferenz. SRF.ch
Schweden – Das Land wählt am 11.9. Zuvor hatte Andersson am Sonntag vor Reportern betont, bereit zur Zusammenarbeit mit allen Parteien zu sein ausser mit den Schwedendemokraten. Sie sei sehr enttäuscht, dass sich andere Parteien in der Hinsicht anders entschieden hätten, sagte sie nach Angaben des schwedischen Rundfunks. Keine Partei werde nach dieser Wahl über eine eigene Mehrheit verfügen. Ihre Sozialdemokraten hätten jedoch gezeigt, dass sie in der Lage seien, auch in komplizierten parlamentarischen Situationen zusammenzuarbeiten.
● Julia Rensberg, 27, eine Sámi aus Nordschweden. Wegen der starken Wetterschwankungen würden ihre Rentiere verhungern, erzählt sie. Früher fanden sie ihr Futter unter dem Schnee. Heute taut der Schnee und gefriert dann zu einer dicken Eisschicht. SRF.ch
Schweiz – Nördlich Lägern ist laut Matthias Braun der sicherste Ort für ein Tiefenlager: Hier eignet sich die Geologie am besten. Die Entscheidung der Schweiz für den Standort ihres Atommüll-Endlagers nahe der baden-württembergischen Ortschaft Hohentengen ist auch jenseits der Schweizer Grenze skeptisch aufgenommen worden. Die Entscheidung der Schweiz bezeichnete man in Berlin am Samstagabend als Belastung für die betroffenen Gemeinden. Die grenznahe Lage «stellt sowohl in der Errichtungsphase als auch beim Betrieb des Endlagers für diese und umliegende Gemeinden eine grosse Belastung dar», sagte Christian Kühn, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium und Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, auf Anfrage. «Ich setze mich bei der Schweiz dafür ein, dass die bisherige gute Einbindung der deutschen Nachbarn fortgesetzt wird.» Die Expertengruppe Schweizer Tiefenlager (ESchT) werde nun im Auftrag des Ministeriums eine Einschätzung zur Nachvollziehbarkeit des Standortvorschlags erstellen und ihn bewerten. Bereits 2006 hatte das BMUV die ESchT eingerichtet, um die Schweizer Endlagersuche fachlich zu begleiten. Die Nagra will sich am Montag genauer zu den Plänen äussern. Zudem ist am 15. September eine Informationsveranstaltung in Hohentengen geplant, in der die Nagra ihre Entscheidung vor Ort erklären will.
● Strom-Verträge ausgelaufen. Horrende Strompreise in Niederhelfenschwil SG. Die Strompreise steigen. Niederhelfenschwil trifft es besonders hart: Der Strom kostet nächstes Jahr dreimal mehr.
● Der Luchs trägt seinen Teil zum Ökosystem bei. Seine Ansiedelung war umstritten, doch heute leben etwa 250 Luchse in den Wäldern der Schweiz.
● Die Appelle sind nicht zu überhören: Wir alle sollen unseren Beitrag leisten, um die drohende Strom- und Gasknappheit zu überstehen. Müssen wir, die den Überfluss gewohnt sind, wieder lernen zu verzichten? Und wie geht das? Licht aus! Nicht zu lange duschen! 18 Grad im Schlafzimmer sind genug! Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, der das Energiesparen immer ernst nahm. In der Übergangszeit feuerten wir das Cheminée ein. Die Bodenheizung kam erst mit dem harten Winter zum Einsatz. Energie kann man auch sparen, wenn keine Knappheit droht. Kalt duschen kann man auch als tägliche Challenge gegen den inneren Schweinehund betrachten. Alles eine Frage der Perspektive. Nun kommen die Appelle nicht aus dem Eltern-, sondern aus dem Bundeshaus. Die Energiespar-Kampagne für die Bevölkerung läuft auf allen Kanälen.
● Mit Strom statt Kerosin zu fliegen, wäre gut fürs Klima und für die Ohren der Anwohnerinnen und Anwohner. Erste kleine vollelektrische Flugzeuge sind schon im Einsatz – auch in der Schweiz. Fürs Trainieren von Starts und Landungen sind sie ideal. Weit reisen kann man mit ihnen aber noch nicht. In Bern trifft sich am Wochenende die internationale EntwicklerInnen-Gemeinde, die das ändern will, zum sogenannten «Electrifly-In». Rolf Stuber war bis vor kurzem Linienpilot bei der Swiss. Heute ist er Tüftler und passionierter Elektroflieger. Aus einem Hangar auf dem Flughafen Grenchen stösst er von Hand einen Pipistrel ans Tageslicht – ein kleines Sportflugzeug mit zwei Plätzen, das es in sich hat. Das erste zertifizierte vollelektrische Flugzeug der Welt wiegt rund 600 Kilogramm. Eine lärmintensive Aufwärmphase, wie sie bei herkömmlichen Sportfliegern nötig ist, braucht ein Pipistrel nicht. Vier Knöpfe einschalten, und los geht’s. Gesteuert wird ein Elektroflugzeug genau gleich wie ein herkömmliches. Allerdings macht es viel weniger Lärm, aber mehr Spass. Der grosse Nachteil von Elektroflugzeugen: ein voller Tank, sprich eine Akkuladung, reicht gerade mal für rund 40 Minuten Flug. Immerhin sind bis zu neun Starts und Landungen möglich, bevor der Elektroflieger wieder an die Steckdose muss. Der Pipistrel sei deshalb perfekt geeignet als Trainingsflugzeug. Starts und Landungen seien das, was Pilotinnen und Piloten ohnehin am meisten üben müssten. Diese brauchen bei fossil betriebenen Flugzeugen aber besonders viel Treibstoff und verursachen viel störenden Lärm. Kommt dazu: wirtschaftlich sind Elektroflugzeuge sehr interessant. Die Betriebskosten liegen bei einem Elektroflugzeug rund 50 Prozent tiefer als bei einem Flugzeug mit Verbrennungsmotor. Auch Sandra Dubach fliegt seit fast 29 Jahren, früher für die Swissair, heute für die Swiss, als Maitre de cabine. Auch sie schwärmt für sogenannte «alternative Antriebe». Der Druck auf die Luftfahrt, klimafreundlicher zu werden, steige rasant, sagt sie und ergänzt: Die E-Mobilität in der Luftfahrt hinkt derjenigen auf der Strasse mindestens 10 bis 15 Jahre hinten drein. Die meisten Kleinflugzeuge seien Oldtimer mit hohen Emissionen und lärmigen Motoren. Um das zu ändern, organisiert Sandra Dubach mit ihrem Team bereits zum sechsten Mal ein sogenanntes Electrifly-In, das Entwicklerinnen und Entwickler von elektrisch und anders alternativ angetriebenen Flugzeugen aus ganz Europa in die Schweiz holt. Gianmario Giacomelli, Vizedirektor im Bundesamt für Zivilluftfahrt und zuständig für Luftfahrzeuge, begrüsst das sehr: Für die grossen Passagierflugzeuge setzen Politik und Branche derzeit darauf, dass herkömmliche Motoren mit klimaneutralen Treibstoffen betrieben werden können. Bei Sport- und Trainingsflugzeugen aber könnten sich vollelektrische Motoren durchsetzen. Anders als bei den grossen Jets, wo internationale Konzerne den Ton angeben, wollen in diesem Bereich Entwicklerteams aus der Schweiz ganz vorne mitmischen. SRF.ch
Tschechien – 70’000 Teilnehmer einer prorussischen Demonstration in Prag. „Wir fordern den sofortigen Rücktritt der Regierung“, sagten die Organisatoren. „Wir fordern die Einsetzung einer provisorischen Expertenregierung und die Ausrufung vorgezogener Neuwahlen. Sollte die Regierung bis zum 25. September nicht zurücktreten, werden wir auf einer landesweiten Demonstration das Protestrecht gemäß der Verfassung der Tschechischen Republik erklären und Zwangsmaßnahmen verkünden Aktionen. Wir verhandeln bereits mit Gewerkschaften, Unternehmern, Landwirten, Bürgermeistern, Transportunternehmen und anderen Organisationen, um einen Streik auszurufen”, warnten sie. An der heutigen Demonstration nahmen nach ihrer Schätzung über 100.000 Menschen teil. Die Organisatoren kritisierten hohe Energiepreise und den prowestlichen Kurs der aktuellen Regierung. Sie baten um die Genehmigung ihrer Vertreter, kurzfristige Verträge über die Lieferung von billigem Gas und Öl abzuschließen. Eine weitere Anforderung war die Neubesetzung des CT-Rates und des Rates des Tschechischen Rundfunks. ČRO.cz
Ukraine – Der Westen wird die Ukraine für den Winterkrieg rüsten. Mit dieser Botschaft ist die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zusammengekommen. Ihr gehören die 30 Nato- sowie knapp 20 weitere westliche Staaten an. Die Botschaft des Treffens richtet sich an die Ukraine, an den Aggressor Russland – aber auch an den Westen selbst, dessen Unterstützung für die Ukraine auf eine immer härtere Probe gestellt wird. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin empfing seine Amtskollegen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland und kündigte gleich zu Beginn des Treffens Kriegsmaterial-Lieferungen im Wert von 675 Millionen Dollar an, darunter Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme und gepanzerte Krankenwagen. Auch Deutschland, Polen und andere Staaten machten Lieferpläne publik. Bereits im Juli hatte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksji Resnikow in einem Schreiben an die Nato auf die Lieferung von Winterausrüstung gedrängt. Die ist wichtig für die Kampfmoral und damit für die Kampfkraft der ukrainischen Truppen. Die Nato will der Ukraine deshalb auch winterfeste Kleidung und Zelte zur Verfügung stellen. Zumal der Unterstützung des Westens zu verdanken ist, dass die Ukraine dem russischen Angriff bislang unerwartet gut standhalten konnte. Kriegsmaterial im Wert von mehr als 15 Milliarden Dollar haben allein die USA seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden der Ukraine geliefert oder in Aussicht gestellt. Nachdem zu Beginn des Krieges als Soforthilfe vor allem leichte Waffen geliefert worden waren, erhalten die ukrainischen Streitkräfte nun auch schweres Gerät. Doch längst nicht alles, was die Ukraine militärisch gebrauchen könnte, will oder kann der Westen liefern. Sogar den USA, der grössten Militärmacht der Welt, gehen die Vorräte aus. Denn in den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Streitkräfte auf Einsätze gegen leicht bewaffnete Verbände wie zum Beispiel jene der Taliban in Afghanistan eingestellt. Für die weiträumigen Artillerie- und Panzerschlachten in der Ukraine sind viele Waffen- und Munitionsbestände schlicht zu klein. Und die Produktionsmenge lässt sich nicht mir nichts, dir nichts vergrössern. Dazu kommt, dass einige europäische Staaten wie etwa Frankreich seit längerem auf Zugeständnisse an den russischen Aggressor drängen und sich mit Waffenlieferungen zurückhalten. Und dass immer mehr Kritik laut wird an den hohen Energiepreisen, die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Anti-Russland-Sanktionen sind. In Tschechien etwa gingen am Samstag nach Polizeischätzungen 70’000 Menschen auf die Strasse. In vielen Nato-Staaten könnten die Regierungen unter Druck geraten, von der Unterstützung der Ukraine Abstand zu nehmen. Auch dagegen wollten die USA ihre Verbündeten heute in Ramstein einschwören. Im Wissen darum, dass der Winter und kriegsmüde Bevölkerungen in den eigenen Ländern Russland Vorteile verschaffen könnten. SRF.ch
Ungarn – Die Orbán-Regierung damit offiziell eingeräumt, dass der langfristige Gasliefervertrag mit Gasprom keine fixierten Preise mehr enthält. Der Minister erklärte aber auch, warum das so ist: „Zu Festpreisen haben wir den Vertrag deshalb nicht geschlossen, weil die EU das nicht zulässt.“ Die Gaspreisformel bilde ein Geschäftsgeheimnis, sei jedoch an der Preisbildung der Rotterdamer Börse ausgerichtet. „Lange Jahre sind wir mit den Festpreisen gutgefahren, heute aber müssen wir Börsenpreise bezahlen. Und die sind richtig unvorteilhaft.“ Die Ungarische Sozialistische Partei MSZP fordert die Senkung des Umsatzsteuersatzes für Energieträger von 27% auf 5%. MR.hu
USA – Die amerikanische Weltraumbehörde Nasa musste Ende August den Testflug auf den Mond verschieben. Auch der zweite Startversuch scheiterte. Thomas Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der Nasa: Beim ersten Startversuch gab es hauptsächlich zwei Probleme: das Wetter und die Technik. Wenn das Wetter gut gewesen wäre, wäre die Rakete nun wahrscheinlich unterwegs Richtung Mond, aber das Zeitfenster war zu klein, um die technischen Probleme zu lösen. In der Zufuhrleitung des flüssigen Wasserstoffs gab es ein kleines Loch. Das Team konnte es zwar schliessen, aber es hat uns Zeit gekostet. Dazu kam noch ein weiterer, einfacher Fehler am Triebwerk. Ein Sensor war nicht gut kalibriert und zeigte an, dass einer der Motoren nicht kalt genug sei. Die Leute hätten diesem Sensor gar nicht so viel Beachtung schenken sollen. Das ist so ein Fehler, der passiert, wenn ein Team zu stark versucht, das Beste zu geben. SRF.ch
 Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte.
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber “CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE” portofrei und gratis! Details hier.


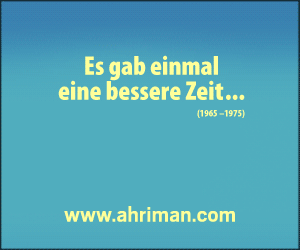







Elektroflugzeuge in der Schweiz – na mal sehen wie viele davon zukünftig mit leerem Akku am Matterhorn hängen bleiben oder spontan zum Notwasserflugzeug werden.
Springer, Ringier, Fellner…
Die Markt und Kriegsschreier der
Atlantik Besatzungsmächte.
Ob Bild ob Welt.
Ob Blick ob NZZ.
Ob Össireich ob Standard…alles Reuters/AP